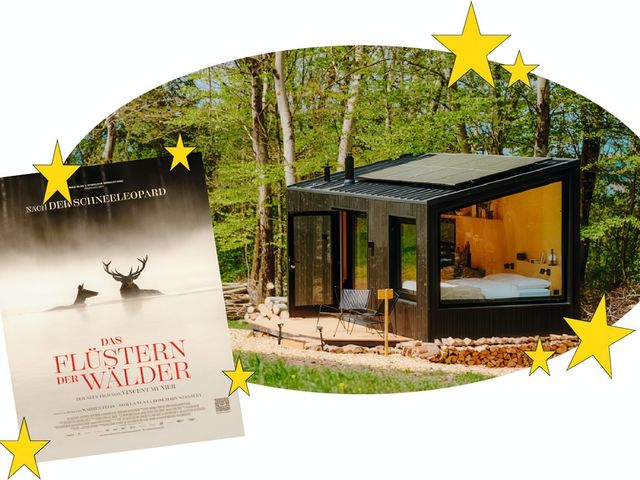Um mich glücklich zu machen, reicht oft schon ein bisschen Frankreich – als ich im Pandemie-Sommer 2021 am Pariser Gare du Nord ankam, nach vielen Monaten ohne überhaupt mal wieder irgendwo anzukommen, weinte ich kurz darauf im Fond eines elektrischen Taxis, während mir der Taxifahrer erklärte, dass die Bürgermeisterin Anne Hidalgo das jetzt einfach so organisiert hat mit den elektrischen Taxis. Ich weinte nicht, weil mir Frau Hidalgos Durchgriff bei der Pariser Verkehrswende so gut gefiel, ich weinte, weil ich da war. Zwei Tage später fuhr ich mit dem TGV weiter nach Nantes, von da nach St-Nazaire und von da nach Lyon, ein paar Monate später durfte ich auch noch nach Straßburg, und es ist nicht allzu lang her, da war ich in Toulouse. Bald fahre ich in die Bretagne.
Es ist emotional undurchsichtig mit mir und Frankreich, es hat mehrere Ebenen. Da ist die Legende von den hugenottischen Wurzeln, das ist extrem undurchsichtig, aber immerhin hieß meine Großmutter väterlicherseits Lisette. Da ist die französische Atlantikküste, die mir doch noch mehr ins Herz greift als jede andere Atlantikküste. Da ist die Tatsache, dass ich zwar in der Schule in Französisch eher schlecht war, aber sobald ich die Grenze zum Nachbarland überquere fast fließend Französisch spreche, angeblich quasi ohne deutschen Akzent. Da war der erste gefühlvolle Kuss am Rand eines Brunnens in Paris, vor über 36 Jahren. Da waren all die Nachtzüge von hier nach da, und ich dann immer mit diesem gewissen Schimmer in den Augen.
Und jetzt folgen Sie mir bitte noch mal in den vergangenen Sommer, und zwar nach Lyon, an die Ufer der Rhône. Es ist Juli, eigentlich war Regen angesagt, aber die Sonne scheint. An den Ufern stehen lange Tische mit Büchern, die örtlichen Buchhandlungen haben sie aufgebaut, an den Tischen sitzen: wir, die internationalen angeblichen Schriftstellerinnen. Vor den Tischen stehen Leute, die unsere Bücher kaufen wollen, und wir signieren das Zeug, und das alles ist so französisch, es ist das pure Glück.
Und zack, stehen zwei Flaschen Wein auf dem Tisch, einmal Weißwein, einmal Rotwein, und doppelzack ist der Wein auch in den Gläsern
Irgendwann ist Zeit fürs Mittagessen. In Frankreich ist irgendwann immer Zeit fürs Mittagessen. Wie auf Knopfdruck bevölkern wir, die angeblichen Schriftstellerinnen und ihre französischen Begleitungen, die Restaurants, das Essen fällt mehr oder weniger vom Himmel, und zuverlässig sagt irgendjemand: »Alors, on boit un coup?«
Und zuverlässig antwortet auch irgendjemand: »Mais oui.«
Oh, là, là, denkt irgendwas in mir, boire un coup? Vraiment? Es ist maximal kurz nach dreizehn Uhr.
Und zack, stehen zwei Flaschen Wein auf dem Tisch, einmal Weißwein, einmal Rotwein, und doppelzack ist der Wein auch in den Gläsern. Oder der Crémant. Oder sonst ein Aperitif. Oder Digestif. Und ich, in grenzenloser Überschätzung meiner Fähigkeiten, weil ich mich in Frankreich eben immer so gut aufgehoben und rundum fantastisch fühle, passe nicht auf. Auch die anderen internationalen angeblichen Schriftstellerinnen passen nicht auf. Also essen, trinken und reden wir alle durcheinander, wie das eben in Frankreich üblich ist, es wird nachgeschenkt, es wird fröhlich am Tisch, die Sonne scheint immer lauter, die Vögel singen immer heißer, die Erde vibriert, und erst beim Dessert, als die skandinavische Kollegin von ihrer kleinen Affäre mit dem portugiesischen Kollegen gleich hier am Nebentisch erzählt, wird mir klar, dass wir innerhalb von knapp 90 Minuten jenen Franzosen, die sich in genau dem Moment Zigaretten anzünden und Sonnenbrillen aufsetzen, weil wir offenbar nur ein kleines bisschen Mittagswein brauchen, um jegliche Contenance zu verlieren, all unsere Geheimnisse verraten haben.