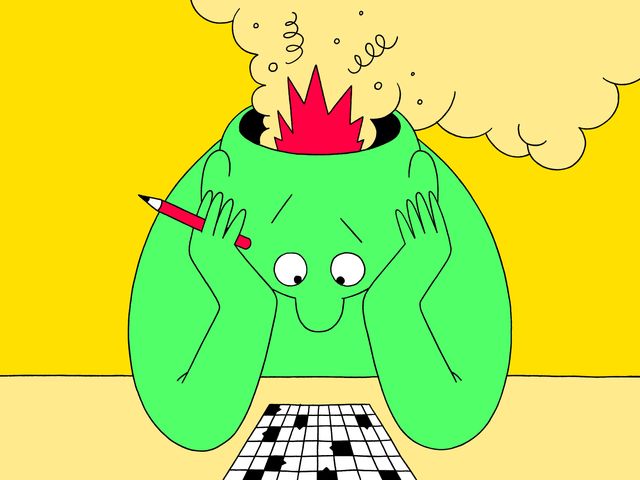Martin Schulz sitzt im Schneidersitz auf seiner Bettdecke und liest. Er will das Buch kurz ablegen und klemmt einen Schokoriegel zwischen die Seiten. Dann hält er inne, nimmt sein Handy, öffnet Twitter und tippt: »Evtl habe ich gerade ein KitKat als Lesezeichen verwendet. Eigentlich genial wenn man drüber nachdenkt.« Der Text erscheint neben seinem Profilbild. Niemand reagiert.
Martin Schulz ist 26 Jahre alt, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen. Er arbeitet in einer Bibliothek und lebt in einer Einzimmerwohnung in Berlin-Lichterfelde, zusammen mit einem grauen Kater, der Avalon von Biesenbrow heißt, Rufname: Dicker. Seit vier Jahren ist Schulz unter dem Namen @munkelmann_ bei Twitter angemeldet. 315 Einträge stehen auf seiner Seite. Im physischen Leben hat er einige Freunde, seinen besten seit der Kindergartenzeit. Auf Twitter hat er zehn Follower, die meisten Accounts davon sind für Werbung erstellte Profile.
»Ich glaube, dass nur zwei echte Menschen darunter sind«, sagt er. Soziale Netzwerke sind eigentlich ein Versprechen, dass jeder jemanden findet, der ihm zuhören möchte. Das potenzielle Publikum ist riesig. Sieben Prozent der Deutschen über 14 Jahre sind angemeldet, weltweit sind es mehr als 300 Millionen Menschen. Doch die Follower sind ungleich verteilt. Während der Sängerin Taylor Swift mehr als 64 Millionen Menschen folgen, also fast die Einwohnerzahl von Frankreich, senden die meisten ins Nichts oder nutzen ihre Profile nicht. Der US-Datenjournalist Jon Bruner untersuchte 400 000 zufällig ausgewählte Accounts. Sie hatten im Schnitt nur einen Follower.
Das müsste nicht sein. Wer »erfolgreich twittern« auf Google sucht, bekommt mehr als eine Million Ergebnisse – inklusive einem »20-Tage-Plan für einen erfolgreichen Twitter-Account«. Der Plan sieht etwa vor, anderen Menschen Komplimente zu machen und ein Foto von sich als Profilbild zu benutzen.
Twitter wird oft als Plattform für selbstverliebte Menschen dargestellt, die sich inszenieren wollen. Offenbar gilt das längst nicht für alle. Martin Schulz schaute nur anfangs regelmäßig, ob ihm Menschen folgen. Bald bemerkte er, »dass es wohl nicht besonders interessant ist, was ich mache«. Aber er war glücklich damit: Wer bei Twitter keine Follower hat, kann senden, was ihn beschäftigt, ohne dafür bewertet zu werden. Kann erzählen, worüber er im Alltag lächeln muss, ohne sich zu fragen, ob auch andere darüber lachen. Einmal veröffentlichte er einen Witz bei Facebook. Seine Schwester wunderte sich darüber so sehr, dass sie ihn zwei Minuten später anrief. »Du? Ein Witz? Was ist los?«, fragte sie besorgt. »Nur wenn man allein ist, ist man frei: Zwang ist der unzertrennliche Gefährte der Gesellschaft«, stellte der Philosoph Arthur Schopenhauer schon vor mehr als 150 Jahren fest.
Martin Schulz veröffentlicht auf seinem Profil ein Foto von einem Blasenpflaster mit Minnie Mouse, das er sich auf die Ferse geklebt hat. »Martin (26) hat neue Schuhe«, schreibt er dazu. An einem anderen Abend tippt er: »Angst, mich nie wieder zu verlieben.« Und er fühlt sich gut, weil er es ausgesprochen hat, »ohne es meinen Freunden zum zehnten Mal erzählen zu müssen«.
Wer ohne Leser vor sich hin schreibt, könnte auch Tagebuch führen und damit ausschließen, dass er einmal bereuen wird, was er erzählt. Aber auf Twitter gibt es die Verbundenheit zu einer schwammigen Öffentlichkeit. Die Möglichkeit, dass doch einmal jemand darüber stolpert und über einen Eintrag lächelt oder davon gerührt ist. Diese Vorstellung reizt Martin Schulz. Jedenfalls solange er nicht wissen muss, wer dieser Mensch ist.
Illustration: Tim Lahan