Nach einer Jugend in der Provinz findet Willem Dafoe, dass die Großstadt der richtige Ort ist, um Kinder aufzuziehen.
SZ-Magazin: Herr Dafoe, auf dem Weg zu diesem Interview saß ich in der Berliner U-Bahn einem Kerl gegenüber, der mich die ganze Zeit bedrohlich anstarrte, da dachte ich: Jetzt müsste man so böse schauen können wie Willem Dafoe.
Willem Dafoe: Die Wahrheit ist: I am a lover, not a fighter. Aber ja, ich würde das gut hinkriegen.
Sie haben viele Verbrecher und Psychopathen gespielt, zuletzt in Wes Andersons Grand Budapest Hotel. Wie viel Böses steckt in Ihnen?
Ich bin in einer Mittelklassefamilie in Appleton im Mittleren Westen der USA aufgewachsen, in einer harmlosen, verträumten Welt. Als ich über die Theaterspielerei Anfang der Siebzigerjahre nach New York gekommen bin, war New York eine gefährliche Stadt. Die Zeiten waren hart, wirtschaftlich schlecht. Ich hatte überhaupt kein Geld, lebte in einer schlechten Gegend: Ich war hier plötzlich nicht mehr Mittelklasse. Zu der Zeit habe ich mir die Maske des harten Kerls zugelegt. Die habe ich nicht nur auf der Bühne gebraucht, sondern tatsächlich auf der Straße, als Schutz.
Warum tragen Sie diese Maske des Fieslings so gern?
Wenn man Angst erzeugt, werden die Dinge oft erst interessant, in einem schauspielerischen Sinne. Die intensivsten Momente im Leben sind oft die, in denen man Grenzen erreicht und überschreitet – und wenn man das auf der Leinwand zeigen will, sind Gewalt und Verbrechen oft der beste Weg. Und es ist lustiger, den Diabolischen zu spielen als einen sensiblen, weichen Charakter.
Wäre es möglich, einen großartigen Film zu drehen, in dem einfach mal kein Mord, keine Tragödie, kein Schicksalsschlag vorkommt?
Ich glaube nicht. Ich überlege, fällt Ihnen ein solcher Film ein?
Mary Poppins?
Denken Sie an den strengen Vater! Nein, wir brauchen Probleme im Film, dann erst können wir uns mit den Figuren identifizieren, eine Handlung ohne Sorgen würde uns nicht berühren.
Sie haben Appleton erwähnt, die Stadt, in der Sie aufgewachsen sind. Sie reden in Interviews immer nur davon, wie Sie die Stadt verlassen haben – aber nie davon, wie es dort war. War es nicht ein guter Ort zum Aufwachsen?
Vielleicht. Ich erinnere mich an die frühen Jahre nicht mehr so. Aber ich möchte gar nicht, dass Sie so viel von meiner Kindheit wissen, weil das Ihre Wahrnehmung von mir als Schauspieler verändert. Das haben Sie immer im Hinterkopf und interpretieren es vielleicht in die Rolle hinein. Als ich ein junger Schauspieler war, fand ich es fast beleidigend, dass Journalisten so besessen von meinem Privatleben waren. Es nimmt mir meine Wandlungsfähigkeit als Darsteller, wenn die Öffentlichkeit ein bestimmtes Bild von mir als Mensch hat. Ich schütze meine Privatsphäre nicht obsessiv, aber ich muss mir Teile davon bewahren.
Ich habe auch nach Ihrer Kindheit gefragt, weil ich überlege, ob ich mit meiner Familie in der Großstadt bleiben soll oder lieber aufs Land ziehe. Wie haben Sie es gehalten?
Ich habe einen Sohn und ich habe es geliebt, ihn in einer Großstadt aufzuziehen. Man kann doch trotzdem in die Natur rausfahren. Es gibt diese romantische Idee des unschuldigen Kindes auf dem Lande, aber ich glaube, eine Stadt ist ein guter Ort, um Kinder zu haben. In einer Stadt, einer großen Stadt, lernt ein Kind, wie viele verschiedene Lebensentwürfe es gibt. Das ist eine mindestens ebenso wichtige Erfahrung. Die Großstadt macht Kinder offener. Und sie können besser entscheiden, was sie selber einmal machen möchten. Es heißt doch: »Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.« Mein Sohn ist am Theater aufgewachsen, darum hatte er nicht nur seine Eltern als Vorbilder, was einengend sein kann. Er hat Menschen kennengelernt, die politisch, sozial, sexuell total unterschiedlich waren. Und hat Toleranz und Offenheit gelernt, die im Leben sehr wichtig sind.
Ihr Vater war Chirurg, Ihre Mutter Krankenschwester, Sie haben sieben Geschwister. Was prägt mehr: Arztkind zu sein oder so eine große Familie?
Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der Ärzte wie Götter behandelt wurden. Die Leute sagten: »Oh, Onkel Joe lag im Sterben und dein Vater hat ihn gerettet.« Ich bin mit dem Gefühl aufgewachsen, dass mein Vater magische Kräfte hat, eine Art Superheld ist, das war seltsam. Entscheidender für mich war, dass beide Eltern so viel arbeiteten. Ich habe sie selten gesehen. Meine Schwestern haben mich großgezogen. Ich habe sehr früh gelernt, für mich selber zu kochen, selbstständig zu sein. Später habe ich bei meinem Vater gearbeitet, um etwas Geld zu verdienen, als Putzkraft. Wissen Sie, ein Krankenhaus zu reinigen, ist sehr spannend.
Ein ganz schön verantwortungsvoller Nebenjob, mangelnde Hygiene im Krankenhaus kann tödlich sein.
Definitiv. Ich habe dabei auch gelernt, nicht zimperlich zu sein. Ich hatte jeden Tag – hart gesagt – mit Blut und Scheiße zu tun.
Ich dachte immer, dass jeder Arzt abends nach Hause geht mit dem Gefühl, ein Held zu sein, bis mir ein befreundeter Arzt sagte, das wäre auch nur ein Job wie jeder andere.
Ärzte entwickeln schnell diesen Pragmatismus im Umgang mit Leben und Tod. Wenn mein Vater wusste, dass einer seiner Patienten sterben würde, ging er sehr sachlich damit um. Ich fand es fast schockierend, dass er nicht aufgewühlter war. Aber das wird wohl zum Alltag, wie Autos reparieren.
Was ist die bessere Kindheit, um Schauspieler zu werden: als Einzelkind permanent im Scheinwerferlicht der elterlichen Aufmerksamkeit zu stehen – oder, wie Sie, als ein Kind von acht um die Aufmerksamkeit der Eltern zu kämpfen?
Ich war der Clown der Familie, das war meine Überlebenstaktik. Mein Weg, um meinen Eltern aufzufallen. So habe ich mit dem Schauspielern begonnen.
Ihr Sohn ist am Theater aufgewachsen und dennoch nicht Schauspieler geworden. Seine Art der Rebellion?
Ich glaube nicht. Obwohl. Hollywood ist voll mit Nachwuchsschauspielern, die Kinder großer Stars sind. Man sieht ja als Kind, dass Schauspieler ein sehr gutes Leben führen, Aufmerksamkeit bekommen, Geld, Ruhm. Aber mein Sohn ist Anwalt für Umweltschutzrecht geworden, Politik interessiert ihn mehr.
»Erst wenn man seine gelernten Verhaltensweisen verlässt, kann man jemand anders werden.«
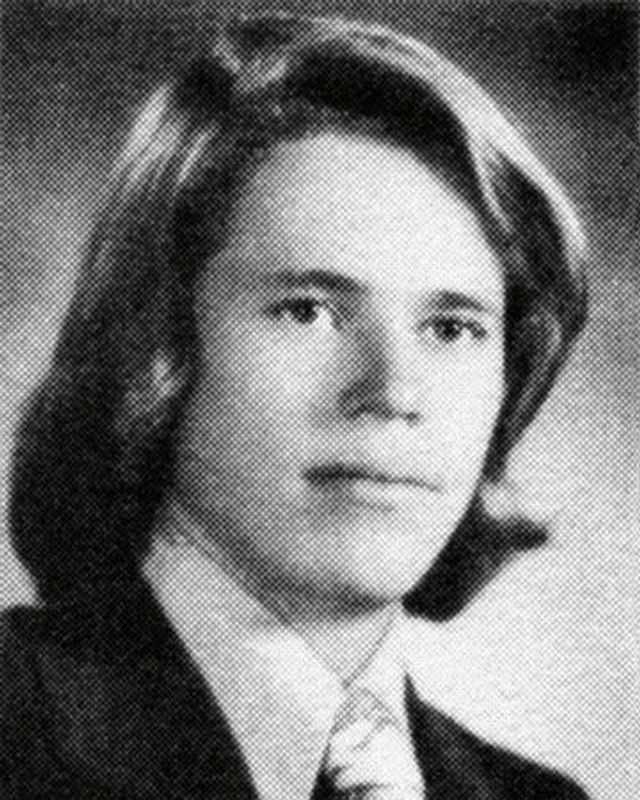
Kann dieser junge Mann zum Monster werden? Auf dem Foto: undenkbar. Auf der Leinwand: ja.
Sie waren in den späten Sechzigerjahren jung, in einer sehr politischen Zeit in Amerika. Ist das bis zu Ihnen nach Appleton durchgedrungen?
Oh ja! Wenn meine älteren Geschwister, die schon studiert haben, in den Semesterferien nach Hause kamen, haben wir gemerkt, wie sie die Universität radikalisiert hat in ihrem Denken. Sie waren alle auf der Universität Wisconsin, da passierte viel, es gab sogar einen Bombenanschlag. Durch meine Geschwister bekam ich das alles mit.
Und doch haben Sie sich für das Theater, für eine Fantasiewelt entschieden. Warum?
Theater, wie wir es gespielt haben, ist politisch, es kann Menschen verändern. Sogar der Hollywoodfilm Spider-Man, in dem ich gespielt habe, hatte eine politische Botschaft. Ich bin politisch engagiert, nur auf eine andere Art als Menschen, die protestieren.
Erinnern Sie sich noch an Klaus Daimler?
Oh, ja. Ein toller Name, nicht?
Das war Ihre Rolle in dem Wes Anderson Film Die Tiefseetaucher. Sie haben Klaus mit großer Ernsthaftigkeit gespielt, aber zugleich mit diesem lustigen deutschen Akzent gesprochen. Eine fremde Sprache ist die Eingangstür in eine Rolle, haben Sie mal gesagt. Nun gilt Deutsch im Ausland als Befehlstonsprache. Was für einen Raum betreten Sie mit dem Deutschen?
Mich so reden zu hören schafft eine Distanz zu dem Willem, den ich kenne. Erst wenn man seine gelernten Verhaltensweisen verlässt, kann man jemand anders werden. Ganz einfache Dinge können der Auslöser sein, ein Kostüm, bayerische Lederhosen.
Sie leben einen Teil des Jahres mit Ihrer italienischen Frau in Rom. Dort spricht man lebendiger, gestenreicher, schauspielerischer. Ist Deutsch verglichen dazu wie ein Korsett?
Nein, so habe ich es nicht empfunden. Was ich an Klaus Daimler mochte, war, dass er so klischeehaft deutsch war, so diszipliniert und fleißig. Wissen Sie, ich kenne genug Deutsche privat, um zu wissen, dass das absolut gar nicht stimmt.
Also sind wir Deutsche doch nicht so überkorrekt?
Klaus Daimler tat, als ob er alles unter Kontrolle hatte, aber eigentlich war er so sensibel und hatte gar nichts im Griff. Das mochte ich an Klaus, sein Scheitern war in seiner Lächerlichkeit so menschlich. Diese Maske der Effizienz, hinter der er unsicher und ineffizient war, wie wir alle.
Sie müssen ein sehr effizienter Schauspieler sein, die Liste Ihrer Filme und Theaterstücke ist beachtlich lang. Gab es Entscheidungen für oder gegen Rollen, die Sie bereuen?
In Hollywood reden die Leute oft darüber, wie anders Filme geworden wären, wenn etwa nicht Vivien Leigh in Vom Winde verweht gespielt hätte, sondern Ingrid Bergman. Ich bereue nichts, aber die Vorstellung ist interessant, was passiert wäre, wenn ich andere Rollen angenommen hätte.
Sie haben Madonnas Liebhaber gespielt und einen Fisch in Findet Nemo gesprochen. Sie hatten die Hauptrollen in Die letzte Versuchung Christi und Antichrist. Kann es sein, dass Sie schon jede denkbare Rolle gespielt haben?
Ich denke nicht so in Rollen, ich denke an die Personen, mit denen ich arbeiten möchte. Ich mag es, nützlich zu sein am Set, ein Werkzeug eines Regisseurs zu sein, das erfüllt mich.
Warum sind Sie nicht in einer der viel gelobten neuen TV-Serien wie Homeland zu sehen?
Ich sehe wirklich nie fern. Das Fernsehen spielt eine viel zu große Rolle in unserem Leben, gesellschaftlich, kulturell. Und beim Fernsehen nimmt man noch viel mehr Rücksicht auf den Publikumserfolg. Zumindest die Kinoregisseure, die ich mag, sehen in Filmen weniger ein Kalkül als TV-Regisseure. Ich bin da altmodisch – ich mag Filme, deren Produktion ein Abenteuer ist.
Auf Twitter schreiben Besucher noch im Kinosaal, ob sie den Film gut oder schlecht fanden. Achten Sie auf so etwas?
Nein. Aber neulich habe ich unter einem Artikel über mich den Kommentar gelesen: »Ich werde so weinen, wenn Willem Dafoe stirbt!« Ich lache, aber das hat mich wirklich bewegt.
Wird Willem Dafoe vor der Kamera alt werden?
Die Kraft alter Schauspieler, die seit sehr langer Zeit vor der Kamera stehen, ist etwas sehr Schönes. Die Weisheit, mit der sie sich vor der Kamera bewegen. Ich hoffe, dass ich das eines Tages erreiche.
(Foto aktuell: reuters; Foto alt: hgm-press)

