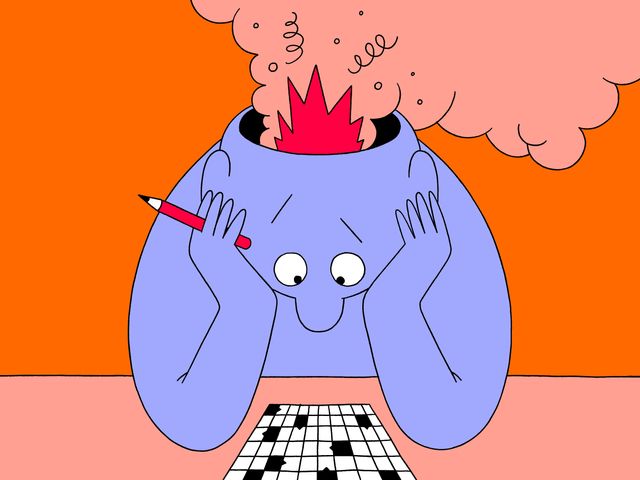Der Algorithmus war kompliziert, das Ergebnis einfach. Und innerhalb der Fachwelt eine kleine Sensation: Ja, es ist möglich, dass der sagenumwobene Sultan Moulay Ismael Ibn Chérif im Lauf seines Lebens 888 Kinder gezeugt hat. Zwar stand der Sultan, auch der Blutrünstige genannt, schon lange im Guinnessbuch der Rekorde als der Mann mit den angeblich meisten Nachkommen, aber wissenschaftliche Nachweise, ob diese Zahl realistisch ist, gab es nicht. Denn 1727, im Todesjahr des marokkanischen Sultans, war die Faktenlage noch nicht sehr verlässlich. Wer konnte schon sicher sagen, ob er sich selbst viele Söhne angedichtet hatte oder sie ihm von anderen zugeschrieben wurden, um seine Macht und Manneskraft in hellerem Licht erscheinen zu lassen?
Dann nahmen sich zwei Verhaltensforscher und Biologen der Uni Wien, Karl Grammer und Elisabeth Oberzaucher, dieses Themas an, das ja zu den großen Mythen zählt: Der Mann, der ewige Jäger, will seinen Samen auf möglichst viele Frauen im gebärfähigen Alter verteilen, um der Nachwelt seine genetischen Informationen zu Verfügung zu stellen. Aber gleich 888 Mal?
Karl Grammer wusste schon, dass ein Mann im Durchschnitt zwischen einem und 28 Mal Sex haben muss, um ein Kind zu zeugen. Das galt natürlich auch für Moulay Ismael und seine angeblich 888 Kinder. Nun entwickelten die beiden Wissenschaftler eine Computersimulation, die die Frage beantworten sollte, wie viele Kopulationen pro Tag notwendig waren, um auf diese Kinderzahl zu kommen. Grundlage dafür war ein Algorithmus, der auf verschiedenen Annahmen beruhte: Wann werden mehr Kinder gezeugt – wenn eine zufällige Auswahl paarungswilliger Männer uneingeschränkten Zugang zu einer nicht genauer festgelegten Zahl Frauen hat? Oder wenn ein Mann auf eine festgelegte Zahl von Frauen wie in einem Harem trifft? Das Ergebnis deutete darauf hin, dass ein Mann mit Harem – wie der Sultan – mehr Kinder zeugen konnte. Zusätzlich verglichen Oberzaucher und Grammer die damaligen sexuellen Gewohnheiten von Frauen während ihrer fruchtbaren Tage, setzten diese ins Verhältnis zur Häufigkeit ihres Eisprungs, zur weiblichen Unfruchtbarkeit (die lag damals, das ergaben weitere Recherchen, bei acht Prozent) und der Sterblichkeitsrate von Embryos vor der Geburt (damals 15 bis zwanzig Prozent). Und natürlich spielte auch die zufällige Zeugung eine statistische Rolle, die lag bei immerhin 58 Prozent. Ergebnis: Im günstigsten Fall muss der Sultan 0,8 Mal Sex pro Tag gehabt haben, realistischer scheinen jedoch zwei Mal Sex täglich, um auf die Zahl von 888 Kindern zu kommen.

Karl Grammer & Elisabeth Oberzaucher: Oberzaucher ist Österreicherin, Grammer ist Deutscher, sie studierte Biologie, er Zoologie. Beide lehren Anthropologie an der Universität Wien und erhielten für ihre Untersuchung über die Zeugungsfähigkeit des Sultans Moulay den eher ironisch gemeinten ig-Nobelpreis.
Wobei man nicht vergessen darf, dass sich der Sultan, Mitglied des marokkanischen Herrschergeschlechts, Umstände schuf, die heute eher selten sind: Er hatte nicht nur vier Ehefrauen, sondern auch einen Harem mit 500 Konkubinen. Eintrittsalter: 15 Jahre, Ausmusterung mit dreißig. Auch dafür fanden die Wissenschaftler Belege. Dazu gingen sie von der Annahme aus, dass er erst mit 25 Jahren begann, Kinder im großen Stil zu zeugen, denn da wurde er König und war in der Lage, einen so großen Harem zu unterhalten. Blieben ihm also bis zu seinem Tod 32 Jahre. Was der Sultan damals nicht wusste, Grammer und Oberzaucher aber per Computersimulation nachwiesen: Um so viele Kinder zu zeugen, hätte er nicht 500 Frauen gebraucht, 140 hätten gereicht.
Wahrscheinlich hat der Sultan jedoch nicht nur 888 Kinder gezeugt, darunter 600 Söhne, sondern 1171. Bloß war es damals in diesen Kreisen üblich, ausschließlich die Töchter, die die Ehefrauen zur Welt brachten, am Leben zu lassen, die Töchter der Konkubinen wurden in der Regel sofort nach der Geburt von den Hebammen getötet. »Pferde wurden besser behandelt als Frauen«, sagt Karl Grammer – das legen Aufzeichnungen nahe, die Reisende zu Lebzeiten des Sultans anfertigten. So weiß man etwa aus den Schriften des französischen Diplomaten Dominique Busnot, dass der Sultan jeden Verdacht der sexuellen Untreue ahndete, auch um sicherzugehen, dass alle Kinder von ihm waren. Eigenhändig riss er untreuen Frauen Zähne aus, schnitt ihnen die Brüste ab oder erwürgte sie.
Wer sich nun selbst ein Bild von den Nachkommen des Sultans machen möchte, muss nur nach Marokko fahren, »denn ein Großteil der Bevölkerung ist mit dem Königshaus verwandt«, sagt Grammer, und auch viele Verwandte des Sultans hatten eine Menge Kinder.
Ganz ausgestorben ist der Mythos vom Mann, der seine Gene im großen Stil der Nachwelt sichert, auch in westlichen Ländern nicht, obwohl hier Monogamie das herrschende Muster ist. Elisabeth Oberzaucher sagt: »Auch bei uns gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Status eines Mannes und seinem Fortpflanzungserfolg sowie der Wahrscheinlichkeit, mehrmals verheiratet zu sein. Nur erfolgt diese multiple Verheiratung in der westlichen Welt sequenziell«, also nacheinander statt gleichzeitig.
Für ihre Arbeit bekamen Grammer und Oberzaucher im September 2015 den ig-Nobelpreis – ig steht für ignoble, also: unwürdig. Es ist eine Art Spaßnobelpreis, den die Harvard University Wissenschaftlern verleiht, deren Forschung »einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt«. Echte Nobelpreisträger überreichten den Preis: einen Blumentopf sowie eine Zehn-Billionen-Dollar-Note aus Simbabwe.
Illustration: Frank Höhne; Foto: Marin Gazzari