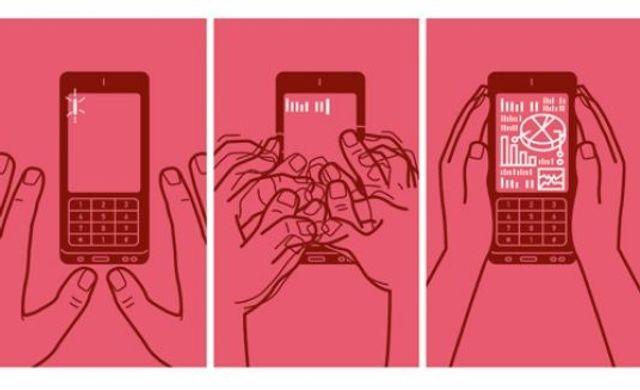Während wir unser Handy zur Not neu programmieren können, haben wir die einfachsten Dinge verlernt...
Wenn es in der Beziehung hakt, in der Seele klemmt, im Beruf nicht läuft, weiß jeder, was zu tun ist: in der Buchhandlung (oder im Internet) eine Reparaturanleitung holen und die Sache wieder in Ordnung bringen. Doch wenn der Pürierstab spinnt? Die Waschmaschine nicht mehr will? Das Hinterrad einen Platten hat? Man könnte ihn zur Not selbst flicken, theoretisch weiß man, wie das geht. Rad ab, Mantel runter, Schlauch aufpumpen und in die gefüllte Badewanne halten, damit man sieht, wo die Luft blubbert, lecke Stelle aufrauen, Flicken daraufkleben, alles wieder richtig herum einbauen, losfahren. In der Praxis scheitert man allerdings an der Frage, wie man die Gangschaltung dabei nicht kaputt macht, wie man den Mantel wieder auf die Felge bekommt, ohne den reparierten Schlauch aufzuschlitzen, sowie an der Unlust, sich die Hände schmutzig zu machen. Deswegen entscheidet man sich für Plan B: zum Fahrradladen schieben und eine Woche warten. Für die Waschmaschine lässt man den Kundendienst kommen, den Pürierstab wirft man weg. Erstens wüsste man nicht, wo man ihn verarzten lassen könnte. Zweitens: Falls es einen Pürierstabreparaturladen gäbe, könnte man sich für die Sanierungskosten fünf neue Pürierstäbe kaufen. Drittens: Wer ist schon so beknackt, einen kaputten Pürierstab wieder heil machen zu wollen? Der moderne Mensch sicher nicht.
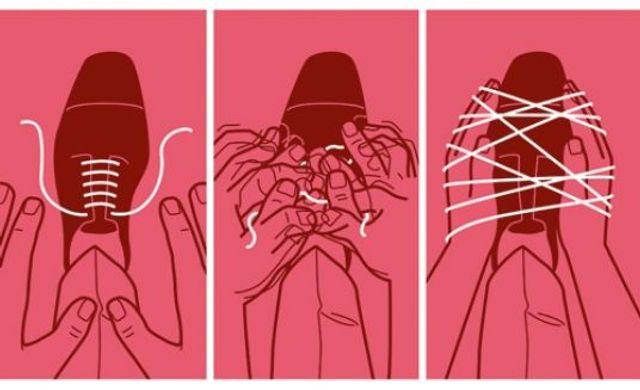
Kaum mehr scheinen wir in der Lage, uns auch nur die Schuhe zu binden.
Sein Vater war da noch anders. Er hatte eine Werkzeugkiste, darin nach Größe geordnet Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hämmer, rechte Winkel, sogar eine Wasserwaage. Sobald im Haushalt etwas zickte, machte er sich selig darüber her, als hätte er nur darauf gewartet, sich ins Innenleben einer Maschine zu verkriechen, bis die Schleuder wieder schleuderte, oder bis er mit chefärztlicher Autorität verkünden konnte: Hilft alles nichts, wir brauchen einen neuen Motor. In der Kindheit kam einem das sonderlich vor – ein Mann, der sich wortlos zurückzog, um die Fenster neu zu dichten oder den tropfenden Wasserhahn trockenzulegen und sich zu Hause zu benehmen wie ein Hausmeister.
Doch jetzt denkt man manchmal: Nicht so schlecht, was der alte Mann draufhatte. Auf einer einsamen Insel hätte er sich mühelos eine Salzwasseraufbereitungsanlage gebaut. Und die Demütigung, für einen lächerlichen Dichtungsring 200 Euro abdrücken zu müssen, weil er nur in Kombination mit Anfahrtsweg und zwei Klempnerstunden erhältlich war, musste er nie empfinden.
Wenigstens hat der moderne Mensch für seine Reparaturinkompetenz bei allem, was sich nicht mit Sekundenkleber flicken lässt, prima Ausreden. Im Unterschied zu noch vor einigen Jahrzehnten sind die meisten Anschaffungen so erschwinglich, dass die Wiederinstandsetzung im Schadensfall kostspieliger ist als ein Neukauf. Statt Metall, Holz und Feinmechanik werden Kunststoff und elektronische Module verbaut, die von Industrierobotern und Billiglohnarbeitern hergestellt werden statt von Fachkräften, deren hohe Lohnnebenkosten vom Konsumenten finanziert werden müssen. Dazu haben sich die Innovationszyklen so beschleunigt, dass genau dann, wenn ein Gerät kaputtgeht, schon Dutzende anderer erhältlich sind, die hundertmal so viel können. Wenn in einer Schreibmaschine der Wagen klemmte oder in einer analogen Kamera der Auslöser hakte, war es sinnvoll, sich ein Ersatzteil zu besorgen und den Schaden zu beheben; wenn eine Digi mit drei Megapixeln spinnt, ist man froh, sie loswerden zu können, weil einem das Gerät selbst wie ein Schaden vorkommt, verglichen mit den 12-Megapixel-Teilen, die mittlerweile auf dem Markt sind. Und welchen Sinn sollte es haben, in einem alten Radio-Rekorder ein paar lose Kabel zu löten (wofür man sich einen Lötkolben, Lötzinn und einen Schaltplan besorgen müsste), wenn es nach der Reparatur weder Kassetten gibt noch analogen Rundfunk, den man aufnehmen könnte?
Außerdem sind viele Geräte schlechterdings irreparabel geworden. Nicht nur, weil mittlerweile auch in Kühlschränken, Geschirrspülern oder Weckern mechanische Hardware, deren Funktionsweise man durch Beobachten und Nachdenken halbwegs verstünde, durch Elektronik ersetzt wurde, der man nicht ablesen kann, wozu sie gut ist. Sondern auch, weil Geräte zunehmend so gebaut werden, dass sie sich nur noch unter Anwendung von Gewalt öffnen lassen. Ein iPhone ist ein sich seinem Besitzer verschließendes Ding, so verklebt und verschraubt, dass man das Werkzeug, das man bräuchte, um in sein Inneres vorzudringen, nur bei Spezialhändlern bekommt. Nicht einmal der Akku lässt sich austauschen; wenn er schlappmacht, schickt man das ganze Gerät zu Apple – und erhält statt eines reparierten Telefons ein neues. Wie viel Ingenieurskunst in ihm stecken mag, auf Langlebigkeit ist es nicht ausgelegt; der Konsument soll einen Grund haben, immer wieder zu kaufen statt nur ein einziges Mal. Es gibt kaum noch Anschaffungen für die Ewigkeit, das merkt man den Dingen an. Die Möbel, die man bei Ikea kauft, sind Lebensabschnittbegleiter bis zum nächsten Umzug und zur nächsten Beziehung und erleiden deswegen oft schon bei der Erstmontur Defekte, die man nie wieder behebt. Geht die paar Jahre auch so.
Unter solchen Bedingungen ist das eigenhändige Reparieren nicht nur altmodische Liebhaberei, sondern fast eine Art privater Revolte – gegen das Tempo, in dem Waren zu Schrott werden, gegen die Wegwerfökonomie und die Verschwendung von Rohstoffen, gegen die Entmündigung der Konsumenten, die ihren Besitz nicht zu gut verstehen sollen, gegen die lieblose Ideologie, dass alles, was Kratzer und Schrammen hat, aus dem Leben rausmuss, gegen das Delegieren der Pflege der Dinge an Spezialisten, deren Geschäftsbedingungen einem unmissverständlich mitteilen, dass jeder Garantieanspruch erlischt, sobald man sich daranmacht, die Maschinen zu öffnen, die man sich angeschafft hat. Durchs Reparieren beginnt man, die Dinge zu verstehen, den Geist, der in ihnen schläft, zu würdigen: So also funktioniert Geschwindigkeit, Zeitmessung, Hydraulik. Erzählt einem ja sonst keiner, wie aus Materie Funktion wird, aus einem Haufen Zeug eine Uhr oder eine Espressomaschine. Das kann man nur selbst herausfinden. Man muss die kaputtgegangenen Dinge dazu nicht einmal erfolgreich verarzten können; es genügt, sie zu dekonstruieren, sozusagen systematisch zu zerstören statt bloß vom Leben verschleißen zu lassen. Auch wenn man mit dem Reparieren oft genug überfordert ist – das Auseinandernehmen sollte man problemlos schaffen. Es ist der erste Schritt, den Geheimnissen der Objektwelt näher zu kommen.
Illustration: Christoph Niemann; Foto: leicagirl/photocase.com