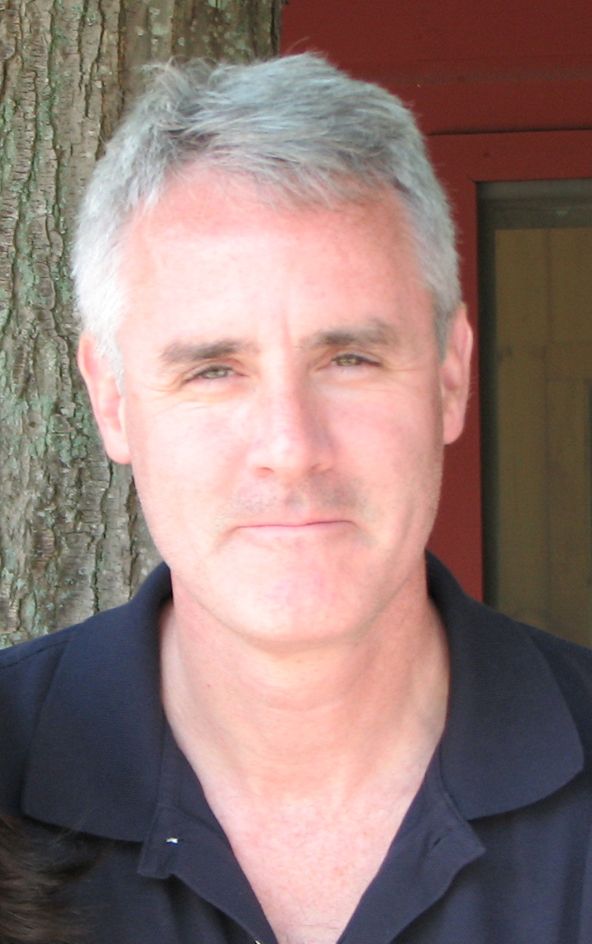SZ-Magazin: Meine Schwiegerlieblinge sind begeisterte Trump-Fans und wir haben komplett aufgehört, über Politik zu reden, weil wir uns sonst so in die Haare kriegen, dass wir uns nicht mehr in die Augen schauen können. Geht das auch anders?
Peter Coleman: Die Frage, die Sie sich zu Beginn jedes Gesprächs stellen müssen, ist: Was versuche ich, hier zu erreichen?
Ich will natürlich, dass sie aufhören, ihn zu unterstützen, und einsehen, dass der Mann viel Schaden anrichtet. Oder anders ausgedrückt: Dass ich Recht habe und sie falsch liegen.
Gespräche führen fast nie dazu, dass jemand seine Meinung ändert. Da brauchen Sie gar nicht erst anzufangen. Vor allem jetzt, mit der politischen Situation in Amerika, den politischen, wirtschaftlichen und moralischen Spannungen. Das ist ein Fieber, in dem Sie kaum jemand direkt überzeugen werden.
Aber ist das nicht der Sinn von Gesprächen? Zehn Zeitungen in Deutschland, darunter auch die Süddeutsche, veranstalten Gespräche mit politisch Andersdenkenden unter dem Motto »Schöner Streiten«. Da steckt natürlich die Hoffnung dahinter, dass auch die Streithähne gemeinsame Nenner finden.
Die Stimmung in Deutschland ist nicht ganz so vergiftet wie in Trumps Amerika. Selbst wenn es um kontroverse, spezifische Themen geht, lohnt es sich zu fragen: Was sind die Umstände, unter denen eine Unterhaltung sinnvoll ist?
Und wie können wir diese Umstände schaffen?
1994 marschierte ein Abtreibungsgegner in zwei Frauenkliniken in Boston, erschoss zwei Frauen und verwundete ein halbes Dutzend andere. Anschließend brachte eine Kollegin von mir mit dem »Public Conversations Project« jeweils drei Wortführerinnen der Abtreibungsgegner und -befürworter zu geheimen Gesprächen zusammen. Geheim deshalb, weil alle Angst vor Drohungen hatten, wenn bekannt würde, dass sie mit der anderen Seite sprechen. Die Abtreibungsgegner versammelten sich vor dem ersten Treffen, um gemeinsam zu beten und sich für die Begegnung mit dem »Teufel« zu wappnen, so angsterfüllt war die Stimmung.
Was passierte dann?
Was anfangs als kurzes Projekt gedacht war, lief fast sechs Jahre. Die Frauen freundeten sich an, erkannten Gemeinsamkeiten, schließlich wollten sie alle das Beste für die Schwangeren, aber das Interessante ist: Während sie sich persönlich näher kamen, lagen sie inhaltlich am Ende noch weiter auseinander als vorher. Vielleicht gerade weil sie sich näher kamen, verspürten sie umso mehr das Bedürfnis, die anderen von ihrer Meinung zu überzeugen. Wenn Sie also als Ziel sehen, Feindseligkeit abzubauen, waren die Gespräche erfolgreich. Die Abtreibungsgegner verhinderten sogar eine weitere Schießerei, indem sie einen aggressiven Anhänger dem FBI meldeten. Die Frauen sind bis heute in Verbindung und veröffentlichten schließlich einen gemeinsamen Artikel mit dem schönen Titel »Mit dem Feind sprechen«, aber keine einzige hat ihre Meinung geändert. Im Gegenteil.
Sie haben ein ganzes Buch über die »fünf Prozent« geschrieben, also die Tatsache, dass jeder 20. Konflikt so ausartet, dass sich die Lager dauerhaft verfeinden. Wie schaffen wir es, nicht zu den fünf Prozent zu gehören?
Tatsächlich sind es eher sechs bis acht Prozent. Die Zahlen stammen aus internationalen Konflikten und beziehen sich auf jene, bei denen sich die Fronten dauerhaft verhärten, etwa beim Israel-Palästina-Konflikt. Sie können das aber auch auf Ihre Ehe oder andere Beziehungen anwenden. Das Erste ist, einen physisch und psychologisch sicheren Raum zu schaffen, in dem beide Seiten ohne Angst sprechen können. Sonst kann das ganz furchtbar schiefgehen. Als die internationale Gemeinschaft Kindersoldaten aus Sierra Leone zusammenbrachte, artete das schnell in Gewalt aus, weil sich die Kindersoldaten vorher im Dschungel töten wollten. Das Zweite ist, auf Zündwörter zu verzichten. Beim Thema Abtreibung einigten sich beide Seiten darauf, Hassbegriffe wie »Babymörder« wegzulassen und sich ganz konkret über die Bedürfnisse der Frauen zu unterhalten. Es macht keinen Sinn, Ihrer Familie zu erklären, warum Trump ein Lügner ist. Man kann aber einen Dialog über kontroverse Themen führen, ohne dass die Atmosphäre toxisch und die Beziehung zerstört wird.
Man denkt ja immer, wenn man der anderen Seite nur genügend Informationen präsentiert, wird sie ein Einsehen haben. Überschätzen wir die Macht der Fakten?
Es hängt ganz viel davon ab, wie ein Gespräch angesetzt wird. Wenn man ein Thema gleich am Anfang als Pro und Kontra präsentiert, also pro Trump oder kontra Trump, für oder gegen Immigration, für oder gegen Abtreibung, treibt man die Teilnehmer viel schneller in zwei Lager, die nur für ihre Seite argumentieren.
Was sollte man stattdessen machen?
Wichtig ist, die Komplexität zu betonen. In unserem Labor zeichnen wir Gespräche auf und anschließend hören sich die Teilnehmer die Aufzeichnung an und markieren dabei ihre Gefühle. Ein Unterschied, der für konstruktive Gespräche entscheidend ist, ist, dass die Teilnehmer zumindest ein wenig guten Willen als Puffer aufbauen. Bei den unergiebigen Gesprächen verschanzen sich die Teilnehmer hinter einer Ich-habe-Recht-du-hast-Unrecht-Haltung und hören nicht mehr zu. Bei konstruktiven Gesprächen ist die emotionale Dynamik komplexer, da gibt es Frust und Wut, aber auch Momente wie »Oh, das ist ein interessanter Punkt, das habe ich so noch nie gesehen.« Da gibt es den Willen zu fragen: »Was meinst du damit genau?« Im Idealfall gibt es auf beiden Seiten den Wunsch, dazuzulernen. Meine Kollegin Katharina Kugler, die nun als Wirtschaftspsychologin an der LMU München arbeitet, hat ein Experiment zum sogenannten Priming gemacht: Wenn sie Teilnehmern vorher Pro-und-Kontra-Listen gab, war das Gespräch viel einseitiger. Die Leute ziehen sich in ihre Haltung zurück. Wenn man ihnen dagegen vorher Material zu beiden Seiten gibt, mit ausgewogenen Argumenten, ist auch die Diskussion viel konstruktiver und die Leute werden offener, sich die andere Seite anzusehen. Dialog ist per Definition der Wille, sich auszutauschen.
Aber wie stellt man den her?
Menschen brauchen ungefähr drei positive Gefühle für jeden negativen Augenblick, sonst mauern sie und machen dicht. An dieser 3:1-Ratio kann man ansetzen. Der Ehe-Experte John Gottman fand, dass es in einer Ehe sogar fünf positive Momente sein müssen, also dass man den Partner fünf Mal wertschätzt bevor man ihn einmal kritisiert, damit eine Ehe hält. Aber Ehen sind viel schwieriger als Politik.
Ursprünglich waren Sie Schauspieler, doch Ihr Interesse an Konfliktbewältigung entfachte, als sie mit gewalttätigen Jugendlichen arbeiteten. Was genau haben Sie da gelernt?
Dass man erst einmal eine Beziehung aufbauen muss. Ich habe in einer geschlossenen Institution gearbeitet, in der Mörder und andere kriminelle Jugendliche lebten. Das war so krass, da kam das SWAT-Team in voller Montur rein, wenn es Ärger gab. Ich fing also an mit »Hallo, ich bin der Peter, ich will dich kennenlernen«, und nahm mir erst einmal Zeit, einen Rapport aufzubauen. Wenn es dann Ernst wurde und ein Konflikt eskalierte, war ich immer der erste, der reinging. Nach dem Motto: »Können wir darüber reden, bevor das SWAT-Team reinstürmt?« Weil wir eine Beziehung aufgebaut hatten, fiel es den Anführern viel schwerer, mich anzugreifen als einen Polizisten, der eine Maske aufhat.
Gleichzeitig ist es aber manchmal viel schwieriger, mit Menschen zu reden, die mir nahestehen und diametral andere Ansichten vertreten, als mit Fremden, deren Meinung mir weniger wichtig ist.
Bei einem Fremden kann man sich immer umdrehen und gehen, wenn einem was nicht passt. Viel hängt davon ab, ob der Konflikt ans Eingemachte geht, also ob die Menschen ihre persönliche Identität daran festmachen.
Was war der wichtigste Konflikt, den Sie moderierten?
Oh, das war gleich am Anfang, als ich an der Columbia anfing. Ein weißer Professor hatte einen dummen Witz gemacht, den die schwarzen Studenten als rassistisch empfanden. Das kochte so hoch, dass der E-Mail-Server zusammenbrach, weil jeder eine Meinung dazu hatte. Ich wurde als Chef der Task Force eingesetzt, die das wieder hinkriegen sollte – ich als junger Hüpfer, das hätte meiner Karriere den Garaus machen können. Ich sagte, ich mache es, aber ich stellte Bedingungen: Erstens, ich brauche einen schwarzen Coach an meiner Seite, das geht nicht, dass ich hier als Weißer einen Rassenkonflikt alleine löse. Zweitens, die aggressivsten Streithähne müssen alle mit in das Komitee. Es hat keinen Sinn, dass sich die Gemäßigten untereinander verständigen, aber die Anführer weiter zündeln. Es dauerte Monate, aber nach einem heißen Sommer war die Sache gegessen. Sie hat zu grundlegenden Änderungen an der Uni geführt. Rassismus wurde danach ganz anders angegangen, darauf bin ich stolz.