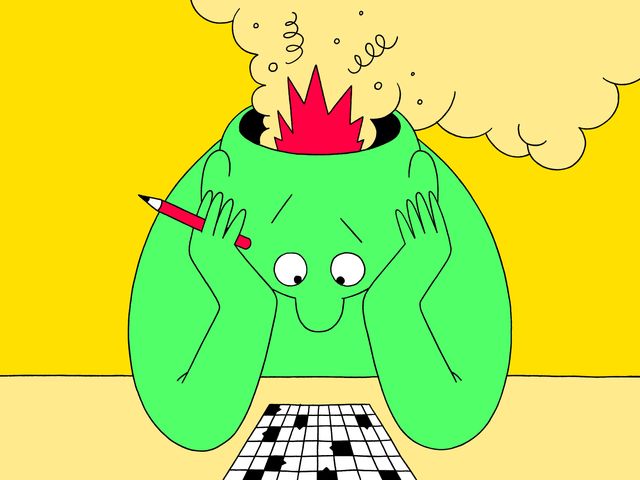Ein paar meiner Freunde finden, dass ich fortschrittsfeindlich sei, aber das stimmt nicht: Ich probiere Neues fast immer aus, bevor ich das Alte meistens besser finde. Bei Craft-Bier war es auch so, aber der Reihe nach.
Vor zwei Jahren war die Apotheke in meinem Viertel plötzlich weg, ein paar Wochen später eröffnete ein Getränkeladen, der hundert Gin-Sorten, fünfzig verschiedene Tonic Water und mindestens fünfzig Biere im Sortiment hatte. Auf den meisten klebten zeitgemäß gestaltete Etiketten mit englischen Namen wie Braukollektiv Knuckelbones IPA oder Crew Republic Hop Junkie. »Fast alles Craft-Biere«, sagte der Verkäufer, »mit einer Extraportion Hopfen.«
Ich habe oft gelesen, Craft-Biere würden von unabhängigen Brauereien hergestellt. Ich weiß bis heute nicht, was eine abhängige Brauerei sein soll, aber ahne, was das heißt, nämlich dass zwei, drei Typen ihren Job bei der Versicherung gekündigt, sich von einem auf den anderen Tag nicht mehr rasiert und ihren Traum verwirklicht haben, im Hinterhof ihr eigenes Bier zu brauen – im Grunde ein Trend aus den USA, der sich vierzig Jahre lang angebahnt hat, seitdem Präsident Jimmy Carter 1978 das Gesetz H.R.1337 unterzeichnet hatte, das den Amerikanern erlaubte, ihr Bier eigenhändig und zu Hause zusammenzupanschen.
Lassen wir an dieser Stelle beiseite, was den meisten ohnehin egal ist, nämlich dass die Insekten-, Vögel- und Schmetterlingsarten immer weniger werden – die Biersorten werden mehr, und das zeigt ja auch, wie vielfältig unsere Welt ist. Man muss sich nicht mehr nur zwischen Pils, Weißbier und Hellem entscheiden, es gibt jetzt allein in Deutschland 250 unterschiedliche Craft-Biere, die mal bernstein-, mal kupferfarben schimmern, mal rauchig, mal cremig, mal nach Mango, mal nach Karamell schmecken. Längst gibt es Craft-Bier-Messen,
-Verkostungen, -Sommeliers, -Bars und -Hotels. Es reicht offenbar nicht, dass wir uns bei Tinder und beim Handytarif nicht entscheiden können, irgendjemand scheint zu wollen, dass Craft-Bier für den Feierabendtrinker wird, was der Fitnesstracker für den Freizeitsportler schon ist – ein Produkt, ohne das man sein Leben kaum noch bewältigen kann. Zum Trend konnte es in den überteuerten Vierteln der größeren Städte werden, weil es sämtliche Sehnsüchte des zeitgemäßen Stadtmenschen in sich vereint, indem es – und jetzt sollte man sich gelegentlich ein »vermeintlich« dazudenken – authentisch, handgemacht, einzigartig sowie regional und international zugleich ist. Es ist nämlich schon gewollt, dass man sich mit so einem Fläschchen aus dem Hinterhof fühlt, als säße man an der Golden Gate Bridge und nicht in einem Wirtshaus in Freising.
Vor einer Woche bin ich noch mal in den Laden gegangen und habe mir wahllos zwei Flaschen gegriffen. Nachdem ich beide probiert habe, muss ich sagen: Kann man machen. Sollte man vielleicht sogar, wenn man neue Erfahrungen sammeln möchte. Das erste schmeckte nach Mango, das zweite nach irischer Felsküste, extrem dunkel, sehr stark, ziemlich bitter, dabei kommt es aus einem Kaff in Oberbayern. »Interessant« trifft es wohl am besten, weil das ja meistens heißt, dass etwas ungewohnt und okay schmeckt, aber nicht so gut, dass es zur Gewohnheit werden könnte.
Craft-Bier wird nach kabellosen Kopfhörern und Barbershops für Männer der dritte Trend innerhalb weniger Jahre sein, den ich vorbeiziehen lasse. Liegt es an mir? Oder an den Trends?