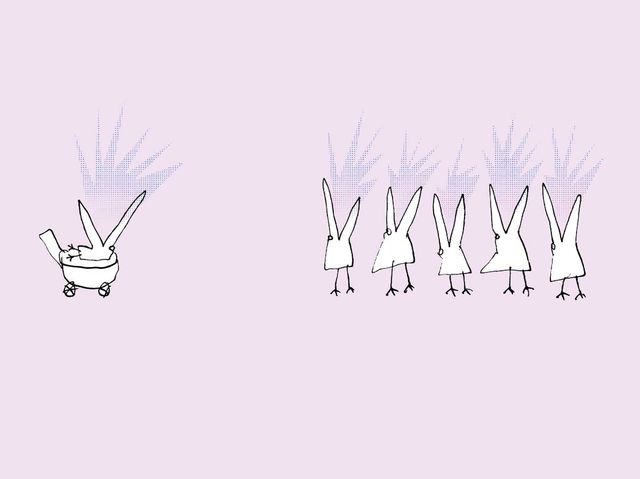SZ-Magazin: Herr Beckenbauer, wann waren Sie das letzte Mal im Kino?
Franz Beckenbauer: Was habe ich das letzte Mal gesehen? Wilde Kerle und natürlich Ice Age, Teil eins und zwei. Mit den Kindern. War lustig. Warum?
George Clooney hat in Up in the Air jüngst einen typischen Vielflieger gespielt, der 322 Tage im Jahr unterwegs ist. Er sagt im Film: »Das waren 43 grässliche Tage zu Hause!«
Das beeindruckt mich jetzt wenig. Wir waren vor der Weltmeisterschaft 2006 insgesamt 330 Tage unterwegs. Ich hätte in dem Film mitspielen müssen – statt Clooney.
Bei Ihnen waren es dann 35 »grässliche Tage zu Hause«?
So empfinde ich das nicht. Ich schlafe inzwischen mehr im eigenen Bett als woanders. Das war zur Hälfte meines Lebens sicher nicht so. Jeder Mensch braucht aber eine Aufgabe. Ich war zeit meines Lebens getrieben von einer Erfüllung als Spieler, als Trainer. Und dann wollte ich natürlich noch die Weltmeisterschaft nach Deutschland holen und zuvor auf der Welcome-Tour alle 31 Länder besuchen, die außer Deutschland teilgenommen haben. Ob das jetzt überflüssig war oder nicht – wir haben es als schöne Geste empfunden.
Selbst in Ihrer Heimatstadt München gehen Sie seit dreißig Jahren ins Hotel.
Ich habe hier ja nichts, keine Immobilie, keine Wohnung. Seit ich vor 33 Jahren nach New York gegangen bin, habe ich keine eigene Bleibe mehr in München. Die Mutter hat bis zu ihrem Tod 2006 hier gewohnt, aber das war jetzt von den Räumlichkeiten her nicht so groß, dass ich da hätte leben können. Ich wollte meine Mutter auch nicht stören. Meistens bin ich im »Vier Jahreszeiten« oder im »Bayerischen Hof«.
Die Anonymität hat Sie nie gestört?
Ich bin ja nichts anderes gewohnt: 1964, da war ich 18, habe ich einen Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Seitdem bin ich auf Reisen. Früher waren es die Sportschulen, die Pensionen, dann die Gasthöfe und später die Hotels. Ansprüche und Annehmlichkeiten sind mit der Zeit gestiegen. Auf unserer Welcome-Tour sind wir sehr verwöhnt worden. Wir haben immer in den besten Häusern übernachtet – ob das in Sydney war im »Marriott« mit Blick auf die Harbour Bridge oder im »Copacabana Palace« in Rio. In dem alten Kasten war ich 1968 das erste Mal, das werde ich nie vergessen. Und natürlich das »Mandarin Oriental« in Bangkok, sicherlich das beste Hotel, in dem ich je war.
Das »Hier bin ich daheim«-Gefühl kennen Sie nicht?
Heimat ist dort, wo ich mich wohlfühle. Das ist auf diesem Breitengrad: München, Kitzbühel und Salzburg, Südfrankreich, Oberitalien. Ich habe mich auch in New York wohlgefühlt, aber ich würde da nicht für immer leben wollen.
Sie haben eben gesagt, Sie seien zeit Ihres Lebens von einer Aufgabe getrieben gewesen. Was meinen Sie damit?
Ich bin ja gelernter Versicherungskaufmann. Ich habe 1959 meine Lehre bei der Allianz angetreten. Aber ich habe mich wie eingesperrt gefühlt. Die Leute waren alle nett. Wirklich! Ich war der Sonnyboy im Büro, schmächtig, unschuldig, die haben mich alle geliebt. Aber ich musste raus, ich habe die Bewegung gebraucht. Der Fußball war für mich die Erlösung. Heute, in der Rückschau, kann ich sagen: Es ist alles so gelaufen, wie ich mir damals mein Leben erträumt habe. Ich hatte ein perfektes Leben.
München-Giesing, wo Sie herkommen, war Ihnen von Beginn an zu klein?
Das habe ich zu der Zeit noch nicht so empfunden. Man hatte noch keine Vergleichsmöglichkeiten: kein Fernseher, kein Internet. Das Einzige, was ich als Jugendlicher hatte, waren die Klebealben von Sanella. Da gab es Bilder von Afrika, von Amerika. Mich hat das interessiert – wie schaut es dort aus? Die Sehnsüchte waren von klein auf da. Dass ich das alles einmal live erleben würde, daran war nicht zu denken.
Das verdanken Sie der »Giesinger Diplomatenschule«, haben Sie einmal gesagt.
Das war doch ironisch gemeint. In Giesing wird man nicht zum Weltstar geboren. Ich hatte das Glück der richtigen Zeit. Ich bin 45er-Jahrgang, da gab es wieder Möglichkeiten. Ich habe mit einem Wollknäuel angefangen Fußball zu spielen, daraus ist mein ganzes Leben entstanden. Es liegt an einem selbst, wie man die Welt betrachtet. Es gibt ja viele, die reisen, aber nichts sehen, weil sie zu beschäftigt sind. Ich war immer neugierig, was sich um mich herum tut. Ich werde nie meine erste Auslandsreise mit dem FC Bayern vergessen, deshalb bin ich auch so ein großer Argentinien-Fan: Das war nach der Weltmeisterschaft 66, wir haben gegen den Weltpokalsieger Racing Buenos Aires gespielt. Die Menschen in Buenos Aires haben auf der Straße Tango getanzt. Das war unfassbar. Argentinien riecht anders als Deutschland. Würziger, schärfer, sinnlicher. Ich habe den Geruch noch heute in der Nase.
Mexiko ist auch ein Lieblingsland von Ihnen?
Durch die beiden Weltmeisterschaften, 1970 als Spieler und 86 als Teamchef, das prägt natürlich. Ich war von der Gastfreundschaft und von der Liebe und Hingabe der Menschen zum Fußball sehr berührt.
Reisen ist heute auch eine Frage des Stils. Wie verreist der Kaiser?
Leicht: Pilotenkoffer, Anzughänger, wenig Gepäck, immer im Anzug. Ich kann doch nicht in der Unterhose und zerrissener Jeans daherkommen, wenn ich für Deutschland unterwegs bin. Und auf jeden Fall pünktlich. Das sind Werte, die mir wichtig sind. Vielleicht hilft mir mein Sternzeichen, Jungfrauen sind sehr ordentlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mag auf niemanden warten. Es gibt ja welche, die permanent zu spät kommen. Die sind bei mir unten durch.
Flugmeilen sind heute ein wichtiges Statussymbol. Für Sie auch?
Wen’s glücklich macht. Für mich macht das Sammeln keinen Sinn. Ich fliege fast immer für andere, ob es der Verband ist oder der FC Bayern. Ich zahle nicht viele Flüge selbst, insofern brauche ich das nicht.
Ende der Siebziger sind Sie für drei Jahre in die amerikanische Profiliga gewechselt, zu New York Cosmos. Die Stadt war damals der Mittelpunkt der Welt. Wie haben Sie New York erlebt?
Von München-Giesing nach New York City, das war ein riesiger Sprung. Ich war mir anfangs nicht sicher: Ich war Kapitän der Nationalmannschaft, die nächste WM stand vor der Tür, es ist mir ja nicht schlecht gegangen. Immer wieder habe ich zugesagt, dann wieder abgesagt. Ich kannte die Stadt nicht, aber ich hatte die Bilder im Kopf. Dann haben die Cosmos-Leute gesagt: Komm doch mal rüber und schau dir an, wer wir sind. Cosmos war Teil von Warner Brothers, und sie haben sich sehr bemüht. Ausschlaggebend war ein Helikopterflug vom Dach des Pan Am Buildings durch Manhattan. Das war für mich der Flug in eine andere Welt. Über den Hudson, raus nach New Jersey zum Giants Stadium, das war damals das modernste Stadion der Welt, mit VIP-Logen. Das gab es in Europa ja alles nicht. Während wir übers Stadion fliegen, habe ich ihnen zugebrüllt: »Also gut, hört’s auf, ich komme!«
Großes Kino.
Ganz großes Kino für mich. In den Siebzigern gab es ja noch diesen Club, »Studio 54«. Da waren alle drin: Hollywood, Rockstars, Künstler. Und wir von Cosmos mit einem eigenen Tisch. Pelé und Carlos Alberto haben das »Studio« aufgemischt, so was hatten die noch nicht gesehen. Plötzlich wurde im »Studio« Samba getanzt, und alle machten große Augen. Was man wissen muss: Pelé ist ein mindestens ebenso großartiger Sambatänzer wie Fußballer gewesen. Ich ja nicht. Ich habe mir das in aller Ruhe mit einem Drink in der Hand angeschaut. Von einer ganz beschaulichen in eine verrückte Welt: Für mich war New York die schönste Zeit in meinem Leben.
Dann müssen Sie die Anschläge auf das World Trade Center, gut dreißig Jahre später, schmerzlich getroffen haben?
Der 11. September ist ja auch noch mein Geburtstag. Ich war nach meiner Rückkehr aus New York jedes Jahr für ein paar Wochen drüben, Freunde besuchen. Nach den Anschlägen bin ich sechs Jahre nicht mehr hin. Weil ich fast täglich, mindestens einmal die Woche, da oben war, im Restaurant im 107. Stock. Die hatten einen deutschen Geschäftsführer, mit jedem, der mich besuchen kam, bin ich da oben hinauf. Das war mein Stammplatz. Der Schock saß so tief, ich konnte das nicht sehen. Für mich unvorstellbar, dass du nach New York kommst, und dann sind die zwei Türme nicht mehr da. Den Anblick wollte ich mir ersparen.
Wo haben Sie damals in den Siebzigern gewohnt?
Central Park South. Das »Navarro« war ein Apartmenthotel, das gibt es heute nicht mehr. Mein Apartment lag im 21. Stock und erstreckte sich über die gesamte Etage. Hinten habe ich auf das Empire State Building geschaut und vorne raus auf den Park. Ich hatte einen 360-Grad-Blick auf Manhattan. Das können Sie heute nicht mehr bezahlen.
Und Sie hatten prominente Nachbarn.
Im »Navarro« wurden von einer Agentur immer Künstler untergebracht, die gerade in New York auftraten: Liza Minnelli, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, wie sie alle hießen. Und Rodolfo natürlich. Nurejew. Ich habe einmal sechs Monate lang Tür an Tür mit ihm gewohnt. Er war an der Met engagiert, und wir haben uns angefreundet, sind oft zum Essen ausgegangen.
Was hat das Ballettgenie Nurejew am Fußballer Beckenbauer interessiert?
Zum Fußball ist Rodolfo nie gegangen, der hat in seiner eigenen Welt gelebt. Er kam eines Tages zu mir und hat mir seine Füße gezeigt. Da habe ich zu ihm gesagt: »Rodolfo, das gibt’s doch nicht. Du kannst doch mit diesen Füßen nicht tanzen.« Ich hatte solche Füße noch nicht gesehen. Entstellt, verkrüppelt. Er hat mich gefragt, ob ich ihm helfen kann. Ich habe unseren Masseur angerufen, der hat ihn professionell bandagiert, und dann ist Rodolfo in der Met wieder drei Meter hoch gesprungen.
Und aus Dankbarkeit wurde mehr. Stimmt es, dass Nurejew in Sie verliebt war?
Sagen wir mal so: Er hat es versucht. Durch die direkte Nachbarschaft sind wir uns fast täglich begegnet. Ich kann mich an ein gemeinsames Essen erinnern im »Riverside Café« in Brooklyn. Dort hat er mir noch vor der Nachspeise mein Knie getätschelt und Avancen gemacht. Ich habe dann zu ihm gesagt: »Du, Rodolfo, lass es gut sein, ich bin von der anderen Fakultät.«
Hat er nicht gewusst, dass Sie einen besonderen Schlag bei Frauen hatten?
Mei, er hat’s halt versucht. Wir haben nie wieder darüber gesprochen, ich war ihm da aber auch nicht böse. Unerwiderte Liebe ist ja ein klassisches Opernmotiv, da wollte ich nicht in der Wunde bohren. Aber: Rodolfo hat mir die Welt der Oper eröffnet.
Sie waren häufiger Gast in der Met?
Das war ich vorher schon. Einer meiner besten Freunde, Jascha Silberstein, war Erster Cellist an der Met. Während meiner New-York-Zeit war ich jede Woche mindestens einmal in der Oper. Von mir zum Lincoln Center waren es zu Fuß nur zehn Minuten. Wenn du alle kennst, Domingo, Pavarotti, Nurejew, dann ist doch klar, dass du hingehst. Ein Fußballer in der Oper, das mag heute undenkbar sein. Für New York war das damals nichts Außergewöhnliches.

In der berühmten Factory von Andy Warhol waren Sie dagegen nie, obwohl der Sie mehrmals eingeladen hatte. Warum nicht?
Ich hatte zu dieser Art von Malerei nicht die ganz große Beziehung. Pop-Art war mir lange fremd. Freddy Quinn, das war mein hero. Dann kamen die Beatles auf, aber auch das hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Kunst und Fußball hatten zu der Zeit kaum Gemeinsamkeiten. Die Kunst hat es immer schon gegeben, aber der Fußball, der ist auf diesem Weltniveau zu der Zeit erst entstanden.
Es heißt gern: New York und Ihre Beziehung zu Diana Sandmann hätten Sie zum Weltmann gemacht.
Ich empfehle jedem, wenn er die Chance hat, ins Ausland zu wechseln. Auch wenn es manchmal gegen die Vereinsinteressen verstößt. Sprache, Kultur, neue Umgebung; das hat schon Goethe gewusst: »Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.« Mich hat es offener gemacht. Diana hat mir vielleicht den Mut gegeben zu sagen: »Ich geh jetzt!« Die Entscheidung musste ich schon selbst treffen. Alle Beziehungen in meinem Leben hatten einen enormen Einfluss auf meine persönliche Entwicklung: nicht stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Aus dem Tunnelleben eines Fußballers auszubrechen.
DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach hat über Sie gesagt: »Egal, wo Franz Beckenbauer hinkommt, er wird nicht nur erkannt, er wird verehrt.«
Das bin nicht ich, das ist die Kraft des Fußballs. Da fällt mir eine schöne Geschichte ein: Wir waren während unserer Welcome-Tour auch in Tokio, und ich liebe Sashimi und warmen Sake. Also sind wir in das »Inakaya«, das uns sehr empfohlen wurde. Nirgendwo kriegen Sie Sashimi frischer als in Tokio auf dem Fischmarkt. Wir hatten gegessen, und wir wussten, es wird imposant teuer. Ein japanischer Geschäftsmann hatte uns zufällig im Lokal gesehen, und ohne dass er was gesagt hat, hat er unsere Rechnung bezahlt und ist gegangen. Er war so begeistert, dass der Beckenbauer in seinem Stammlokal sitzt, da haben ihn die Emotionen überrannt. Er soll sogar geweint haben.
Also doch: Beckenbauer-Kult.
Ach, Schmarrn. Aber manchmal war es schon grenzwertig. Während der Bewerbungs-Tour waren wir auch in Paraguay. Vormittags hatten wir uns die Iguazú-Wasserfälle angeschaut, später wollten wir zum Spiel Brasilien gegen Venezuela. Da es abends ziemlich frisch wurde, wollte ich mir noch einen Pullover kaufen. Als ich im Laden stehe, ruft eine hübsche Verkäuferin laut meinen Namen. Und plötzlich war ich von Dutzenden bildhübschen jungen Mädchen umstellt, die ein Riesengeschrei veranstaltet haben. Das war surreal. Dass die vielleicht den Roque Santa Cruz gut finden, okay. Aber mich alten Dackel?
Sie wurden von unzähligen Staatsführern empfangen. Ist Ihnen der Umgang mit den Mächtigen leichtgefallen?
Da muss man unterscheiden: Wenn man von Politikern spricht, die kommen und gehen. Aber so ein Scheich von Saudi-Arabien oder der Emir von Katar, der bleibt. Das sind schon bedeutende Leute. Und ich habe immer wieder festgestellt: Je größer einer in der Wertschätzung ist, umso bescheidener ist er im Auftreten. Das Problem ist die Entourage, die alles so dramatisiert. Gegenüber einem Kronprinzen im asiatischen Raum sollte ich einmal einen Diener bis zum Boden machen, weil das halt so Usus ist. Da habe ich mich verweigert. Ein Skandal, ein staatspolitisches Fettnäpfchen, aber der Prinz war begeistert. Er sagte zu mir: »Sie sind seit Langem der Erste, der sich das traut. Kompliment!«
Stimmt es, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien Ihnen die Polygamie ausgeredet hat?
Das war ein Bankett mit Thronfolger Prinz Sultan, er war damals Sportminister. »Your Highness«, habe ich gesagt, »mich würde interessieren, nicht so sehr vom Glauben her, aber mit vier Frauen: Wie geht denn das?« – »Vergessen Sie das«, meinte er. »Jede stellt heute Ansprüche. Kaufst du einer einen Ring, wollen die anderen drei einen Ring, der noch viel teurer ist. Es ist lange nicht mehr so lustig, wie es früher einmal war.«
Wir müssen noch über Ihren Besuch in der deutschen Botschaft in Botswanas Hauptstadt Gaborone reden.
Sie meinen die Spinne von Gaborone? Das war die unruhigste Nacht meines Lebens. Uns zu Ehren gab es einen Empfang, ein Mitarbeiter der Botschaft zeigte mir nach dem Essen sein Bein. Es war rabenschwarz. Auf dem Golfplatz hätte ihn eine Spinne gebissen und er wäre beinahe daran gestorben. Er hat überlebt, nur sein Bein würde sein ganzes Leben so bleiben. Nach dem Empfang gehe ich über den Golfplatz zurück ins Hotel. Ich lege mich ins Bett, und plötzlich geht’s neben mir los. Krabbelt doch eine Spinne über das Laken. Ich habe sie mit dem Finger gegen den Vorhang geschnalzt. Aus Angst, dass die Spinne zurückkommt, habe ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. So ein pechschwarzes Bein wollte ich wirklich nicht bekommen.
Malis Frauen haben Sie da in besserer Erinnerung.
Das muss ich sagen. Mali hat die schönsten Frauen. Feinste Gesichtszüge, hohe Wangen, mit welcher Anmut sie die Tonkrüge auf ihren Köpfen tragen, mit durchgedrücktem Rückgrat, ein Gang wie Königinnen. Eines der ärmsten Länder der Welt, aber die schönsten, stolzesten Frauen.