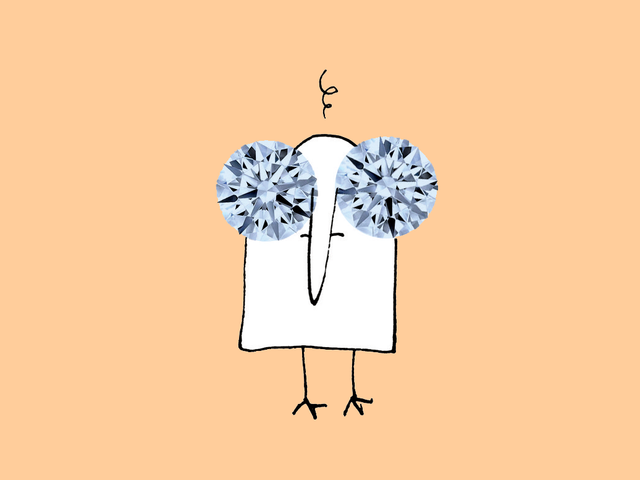Al Green sitzt in einem Sessel, redet über seine neue Platte und klatscht lachend in die Hände. Aber dann hat es auf einmal den Anschein, als sei er mit den Gedanken ganz woanders. Nicht hier, in einem Hotel in New Orleans, wo er Werbung für das Album Lay It Down macht. Sondern in jener Kirche in Memphis, der er seit über dreißig Jahren als Pfarrer vorsteht. Eben noch hat er erzählt, wie er, mit einem Blatt Papier auf dem Boden des Studios liegend, bis zur letzten Sekunde an den Liedtexten feilte; jetzt wechselt er abrupt das Thema und berichtet von den Sorgen und Nöten in seiner Gemeinde. »Die Benzinpreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen«, seufzt er.»Zu meiner Kirche gehören viele arme Leute, die sich das alles kaum noch leisten können. Wir verteilen Essen an Obdachlose und Arme, wir versuchen zu helfen. Aber vor allem müssen wir auf Gott vertrauen! Dann wird es bald wieder besser werden.«
Noch bevor sich Mitgefühl mit den Armen von Memphis einstellen kann, wird aus dem Pastor wieder der Popstar. Green wirft die Arme hoch, sodass die goldenen Ketten an seinem linken Handgelenk laut klappern, und ruft: »Ich bringe ein Album namens Lay It Down heraus. Können jetzt alle bitte einmal ›yeah‹ sagen!« Die Pressebetreuerin der Plattenfirma – sonst ist niemand anwesend – flüstert schüchtern »yeah«, doch von der spärlichen Reaktion auf seinen Gefühlsausbruch lässt Green sich nicht beirren. Er klatscht erneut in die Hände und beginnt, das Titelstück des Albums zu intonieren. »Lay it down, lay it down, put your head on my shoulder«, singt er, und sobald sein honigzartes Falsett ertönt, scheint ein Zauber durch das öde Hotelzimmer zu wehen. Nach wenigen Sekunden ist aber auch diese Episode wieder vorbei und Al Green beendet die Darbietung mit einem kehligen »Danke, Jesus!«
Es ist diese Persönlichkeitsspaltung, die Al Greens Karriere so einzigartig macht. Zum einen ist er der »größte lebende Soul-Sänger« (Los Angeles Times), ein Popstar, der mit seiner Musik zu Ruhm und Reichtum gelangte; zum anderen sieht er sich als Diener Gottes, dessen Aufgabe darin besteht, Christi Wort zu verkünden und nach den Geboten der Bibel zu leben. Die Spannung zwischen Heiland und Hitparade durchzieht sein gesamtes Leben. Sie ist der Kern seiner Kunst, denn sein Gesang schöpft zu gleichem Maße aus der Ekstase der afro-amerikanischen Gemeinden wie aus der Intensität des Blues; aber sie quälte ihn auch so sehr, dass er 1979, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, die Soulmusik an den Nagel hängte, um in der Full-Gospel-Tabernacle-Kirche in Memphis auf der Kanzel zu stehen. Erst seit fünf Jahren nimmt er wieder Musik auf, die nichts mit Jesus zu tun hat.
Greens Zerrissenheit, die subjektiv empfundene Unvereinbarkeit von Kirche und Showgeschäft, erscheint dabei durchaus anachronistisch. Selbst in der Soulmusik mit ihren Wurzeln im Glauben haben Künstler wie Sam Cooke und Aretha Franklin lange vor Al Green gezeigt, dass man in die Hitparaden kommen kann, ohne sich als armer Sünder fühlen zu müssen. Warum gelang das Al Green nicht? Verantwortlich für sein lebenslanges Dilemma ist sein Vater, ein strenggläubiger Christ mit klaren Vorstellungen von gut und böse. »Für ihn gab es Gottes Musik und die Musik des Teufels«, schreibt Green in seiner Autobiografie Take me to the River. »Es gab nichts dazwischen und nichts daran herumzudeuteln.« Trotzdem schlich sich der Vater gelegentlich davon, um in Nachtclubs den Blues zu hören. So erbte der Sohn einen unausgegorenen Komplex von Wertvorstellungen, widersprüchlichen Leidenschaften und Schuldgefühlen.
Der wutentbrannte Vater zerbrach die Singles, warf den Plattenspieler auf die Straße und den Sohn gleich mit. Al Green verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht mehr zurück
Mitte der Sechziger kam es in der elterlichen Wohnung zu einer Schlüsselszene, die Al Green in seiner Autobiografie schildert. Obwohl Popmusik bei Strafe verboten war, hatte Al als Teenager einen Plattenspieler und ein paar Singles in sein Zimmer geschmuggelt. Nun spielte er seine Lieblingssingle von Jackie Wilson ab – zuerst ganz leise, dann ein kleines bisschen lauter, dann noch lauter. »Ehe ich mich versah, dröhnte die Musik aus dem kleinen Lautsprecher und ich sang aus voller Kehle mit. In diesem Moment flog die Tür auf und ich erkannte die Silhouette meines Daddys im Gegenlicht.« Der wutentbrannte Vater zerbrach die Singles, warf den Plattenspieler auf die Straße und den Sohn gleich mit. Al Green verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht mehr zurück – der Soulmusik hatte er seine Familie geopfert.
Einen Ersatz-Vater fand Al Green Ende 1968 in einem schäbigen Musikschuppen in Midland, Texas, als er nach einem ersten, kleineren Hit über die Dörfer tingelte. Der Bandleader und Produzent Willie Mitchell, zufällig am selben Abend dort gebucht, hörte in Greens Stimme ein Potenzial, das wohl nicht einmal Green selbst dort vermutet hätte. Mitchell holte Green nach Memphis, wo die beiden für die Plattenfirma Hi Records innerhalb von zwei Jahren eine Hitformel entwickelten, die bis heute, wie Klassiker wie »Tired Of Being Alone« und »Let’s Stay Together« bezeugen, zu den prägnantesten Popsounds der Siebziger gehört.
Die instrumentale Begleitung ist dabei aufs Wesentliche reduziert: ein stoischer Beat, sparsame Gitarren- und Bläserakzente, melodische Streicher. Dieses harte, unzerbrechliche Fundament erlaubt es Al Green, so zärtlich und gefühlvoll zu singen, wie man es vorher im Soul nicht kannte. Mit einer Mischung aus Instinkt und phänomenaler Technik jubiliert er im Falsett und knurrt aus dem Magen heraus, dehnt und verdichtet, samtweich in einem Moment, rau wie Schmirgelpapier im nächsten. »Es ist ein Gesangsstil«, so Green, »in dem Kontrolle ebenso viel zählt wie loszulassen und in dem eine einzige Note genauso überzeugend wirken kann wie ein gesamtes Symphonieorchester.«
Vor allem ist der Gesangsstil von Al Green aber verdammt sexy. Die Engländer haben dafür den Ausdruck baby making music erfunden, Musik zum Kindermachen. »Ich konnte es erst gar nicht glauben«, sagt Green und spricht nun wieder im strengen Tonfall des Pfarrers. »So etwas Schlimmes darf man doch nicht in der Zeitung schreiben!« Im nächsten Moment grinst er schelmisch und der Pfarrer hat Pause. »Andererseits ist da auch etwas dran. Du legst ›Tired Of Being Alone‹ auf, machst ein Feuer im Kamin, holst eine Flasche Weißwein, sagst ihr, wie schön sie ist, streichst ihr übers Haar – dann bist du bald im Himmel!«
Dieses Rezept hat Green oft genug selbst angewendet, in den Siebzigern galt er als Schwerenöter von Rang, auf einer Stufe mit Sexsymbolen wie Mick Jagger und Steve McQueen. Seine zahlreichen Affären kulminierten allerdings in einem traumatischen Ereignis: Eine eifersüchtige Geliebte übergoss ihn mit einem Topf kochend heißer Grütze und erschoss sich dann in seinem Schlafzimmer.
»Während meiner langen Genesung widmete ich mich dem Studium der Bibel«, schreibt er in seinem Buch, und die Hinwendung zum Glauben hatte die überraschende Folge, dass er nun bei Konzerten unvermittelt zu predigen anfing, mitten im Lied, zur Verwunderung von Band und Publikum. Ein Sturz von der Bühne, den er als Zeichen Gottes interpretierte, führte 1979 schließlich zur radikalen Abkehr von der Popwelt. Die Öffentlichkeit reagierte konsterniert, doch: »Pfarrer Al Green zu werden war für mich die natürlichste Sache der Welt, so wie das Predigen für mich genauso natürlich war wie das Singen.«
Heute macht Al Green immer noch den Eindruck eines komplexen Mannes voller Widersprüche. Seine Jovialität und sein Charisma wirken bisweilen wie ein Schirm, hinter dem er seine wahre Persönlichkeit versteckt, und auch für Mitarbeiter ist er schwer zu durchschauen. »Bei ihm weiß man nie, woran man ist«, bestätigt eine langjährige Pressebetreuerin. Doch zumindest scheinen ihn seine Widersprüche, anders als früher, nicht mehr zu quälen. Der Grund dafür liegt in der Erkenntnis, dass seine alten Hits doch nicht so sündig sind, wie Green lange glaubte. »Nach 15 Jahren als Pfarrer habe ich erkannt, hey, Gott ist Liebe«, erklärt er. »Und Christus ist das Glück der Erde. Du hast Liebe [love] und du hast Glück [happiness]. Zusammen ergibt das …« Er macht eine Kunstpause, doch es ist klar, worauf der Gedankengang hinausläuft: »Yeeaah, love and happiness«, singt er, die Worte eines seiner größten Hits.
Für diese Bibel-Exegese würde Al Green wohl keinen Doktorhut bekommen, doch führte sie zu einem Spätwerk, das wohl niemand für möglich gehalten hätte. Lay It Down ist das dritte Popalbum, das er seit 2003 veröffentlicht hat, und das beste: Der einmalige Sound seiner Siebziger-Alben wird behutsam erneuert, ohne dass die Magie verloren geht. Dementsprechend begeistert ist Green von seinem Werk. »Ich habe bewusst ein weltliches Album geschrieben«, sagt er. »Ich habe es meiner Gemeinde vorgespielt – sie lieben es! Wir sind doch alle nur Menschen. Ich bin Pfarrer, aber ich bin gleichzeitig ein Mensch. Lay It Down bedeutet, wenn du müde bist, bin ich auch müde. Aber der Bund zwischen uns gebietet –«, er klatscht vor Vergnügen in die Hände, »– dass wir uns gleich an die Wäsche gehen!« Amen.
Zuerst erschienen im SZ-Magazin 23/2008.