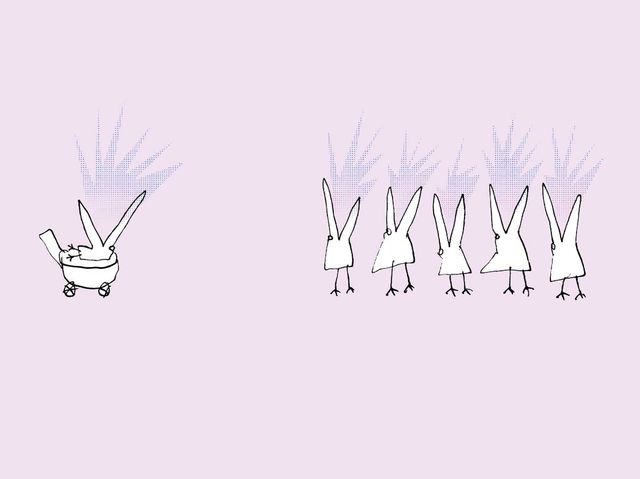Wären Beweggrund und Aussage nicht so derart daneben, könnte ich mich über die Kreativität mancher Menschen ja amüsieren. Da machen sich doch wirklich einige die Mühe, meinen Kopf auf den Körper eines Walfisches zu montieren, mich vor ein überquellendes Tablett an einen Kindertisch bei McDonald’s zu photoshoppen oder Bildcollagen von mir und Homer Simpson zu basteln. Ich schreibe »wäre« und »könnte«, weil das, was mir seit einigen Monaten im Internet widerfährt, alles andere als amüsant ist. Es ist verletzend, menschenverachtend und teilweise sogar strafbar.
Und ich bin in guter Gesellschaft. Hass-Attacken in den sozialen Netzwerken, wie ich gerade eine erlebe, treffen regelmäßig Menschen, die im Bereich Antidiskriminierung tätig sind oder die selbst einer diskriminierten Gruppe angehören. Mitstreiterinnen für die Gleichwertigkeit aller Körper zum Beispiel, wie die Autorin Magda Albrecht oder Ricarda Lang von der Grünen Jugend, deren Namen auch in den Hasskommentaren an mich zu lesen sind. Aus diesem Grund möchte ich hier über meine Erlebnisse schreiben - und dabei klar benennen, was diese Kommentare sind: psychische Gewalt. Ausgeübt von Tätern, die sich in meinem Twitter-Konto einen Wettstreit um die härteste Beleidigung liefern, die mir ihre Vorurteile mit Hass verquirlt in die Timeline tippen und mir in Einzelfällen den Tod wünschen. Man könnte meinen, ihnen wäre es egal, dass hinter jedem Profil ein Mensch mit Gefühlen steckt - aber das Gegenteil ist der Fall. Denn sie wollen diesen Menschen treffen, mitten rein in seine Gefühle. Ich bin eine Zielscheibe für sie, und das Cyber-Mobbing ist ihr Sport. Ein Freizeitspaß, mehr nicht. Das hat im Übrigen einer meiner Hater genau so bestätigt, nachdem das SZ-Magazin ihn ausfindig gemacht und ihn in einem Telefongespräch nach dem Antrieb für seine Beleidigungen gefragt hatte. Es gehe ihm vor allem um die Unterhaltung, sagte er.
Unterhaltsam finde ich das Ganze wirklich nicht, aber ich kann heute, mit über 40, damit umgehen. Weil ich es ein Stück weit einordnen kann. Wäre ich als Teenie so mit Hass überzogen worden - ich weiß nicht, was das mit mir gemacht hätte. Mittlerweile schaffe ich es, diesen Hass in etwas Positives umzuwandeln: in Motivation. Denn er zeigt mir deutlich, wie wichtig der Kampf gegen Diskriminierung im Allgemeinen und Gewichtsdiskriminierung im Speziellen ist.
Dieser Kampf war ja überhaupt erst der Auslöser dafür, dass ich mir einen Twitter-Konto zugelegt habe. Ich wollte dort unter dem Hashtag #DarüberReden über meine Diskriminierungserfahrungen als dicker Mensch twittern, und damit die Aufklärungskampagne der Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützen. Ich eröffnete das Konto am 20. Oktober 2018. Sieben Tage später hatte ich auf meine Tweets hin über 1000 Erwähnungen und Kommentare bekommen; die Anzahl meiner Follower stieg innerhalb kurzer Zeit in den vierstelligen Bereich. Ich hatte die erhoffte Aufmerksamkeit für mein Anliegen. Doch der überwiegende Teil der Kommentare waren nichts als Beschimpfungen und Verleumdungen. Am Anfang versuchte ich noch, all jenen zu antworten, die in eine sachliche Diskussion einsteigen wollten. Ziemlich schnell drang ich zu den paar Kommentaren nicht mehr durch, zu dick war die Schlammschicht aus Hass, die sich über mein Benutzerkonto gelegt hatte.
Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, feiern eine digitale Party auf Kosten meiner analogen Lebensqualität
Mir fiel auf, dass sich viele dieser Kommentare stark in Wortwahl und Grammatik ähnelten, und dass die Profile derer, die sie absonderten, vollkommen anonym waren und meist selbst kaum Follower hatten. Mittlerweile weiß ich, dass es einen Fachbegriff für diese Art von Konten und ihr Vorgehen gibt: »Sifftwitter«. Das umschreibt ein Netzwerk aus Menschen, deren Hobby es ist, Mitglieder von Randgruppen und Andersdenkenden im Internet aufzuspüren und diese systematisch fertigzumachen. Ich war und bin offenbar der perfekte Angriffspunkt für diese Trolle: Weil ich den Mund nicht zu mache, wenn mir jemand schreibt »Lösch Dich!«, was auf Twitter so viel wie »Halt’s Maul« bedeutet, sondern lieber zur Gegenrede anhebe. Bevorzugt außerhalb von Twitter. Das stachelt die Hater-Community zusätzlich an, und mir ist klar, dass ich ihr mit diesem Text Genugtuung verschaffe, indem ich sie thematisiere und ihnen die so sehnlich erwünschte Aufmerksamkeit verschaffe.
Ich nehme das in diesem Moment in Kauf, weil es für mich eine Möglichkeit ist, Gewichtsdiskriminierung sichtbar zu machen. Und dieses Mal schreibe ich nicht über etwas, das passiert ist, sondern über etwas, das passiert. Jetzt. In diesem Augenblick. Und das auf Twitter sogar nachgelesen werden kann im Rahmen der Kampagne und im Fahrwasser dieser Kolumne. Das hat etwas verändert. Die Gewichtsdiskriminierung hat zum ersten Mal ungefiltert die erreicht, die meine Arbeit verfolgen und begleiten. Nach dem Erscheinen der ersten Folge dieser Kolumne hat mich die Redaktion des SZ-Magazins gefragt, ob es mir gut gehe - weil sie die Twitter-Kommentare gesehen hatte. Nein, gut geht es mir damit nicht. Diskriminierung tut nicht gut. Aber sie begleitet mich schon so lange, dass ich Strategien entwickelt habe, mit deren Hilfe ich solche Attacken aushalten kann.
Die wichtigste davon ist Beschäftigung. Solange ich arbeite oder mich mit Freunden treffe, bin ich abgelenkt, dann funktioniere ich einfach. Mein Leben fühlt sich dann wie ein vertrauter Film an, der vor meinen Augen abläuft, und wie im Kino löst sich mein Zeit- und Raumempfinden ein Stück weit auf. Komme ich nach Hause und habe erstmal nichts vor, falle ich in ein Grübel-Loch. Manchmal bedarf es Überwindung, nach so einer Nacht am nächsten Morgen wieder die Jacke überzuziehen und vor die Tür zu gehen. All dem wieder die Stirn zu bieten. Und ja, es gibt schon mal einen Tag, wo das nicht geht, weil der Akku einfach leer ist. Weil Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, eine digitale Party auf Kosten meiner analogen Lebensqualität gefeiert haben. Sie hatten den Spaß, ich habe den Kater.
Bei all dem gibt es dennoch etwas, das mich erheitert. Aus den Kommentaren der Trolle kann ich herauslesen, dass einige sich intensiv mit meiner Arbeit auseinandersetzen. Sie sehen sich alte Fernsehsendungen mit mir an, um Videoausschnitte zu machen. Sie lesen die politischen Forderungen der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, um sie ins Lächerliche zu ziehen, und manche von ihnen lesen diese Kolumne. Ich koste sie also ebenfalls Zeit und Kraft.
Das kann nicht wiedergutmachen, was diese Trolle in meinem und im Leben vieler anderer anrichten. Trotzdem nehme ich aus diesen Erfahrungen etwas mit: Die Gewissheit, dass ich aktiv noch mehr tun muss für Akzeptanz als ersten Schritt zu einer Wir-Gesellschaft, in der jeder Mensch denselben Wert hat. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für all jene, denen es ähnlich geht wie mir. Deshalb führt mich mein Weg nun in die Politik - und deshalb ist dies die letzte Folge meiner Kolumne »Über Gewicht«. Danke, dass Sie mich bis hierhin begleitet haben. Ich hoffe, dass wir uns auf diesem nächsten Abschnitt meines Weges wiedersehen.
Protokoll: Sara Peschke