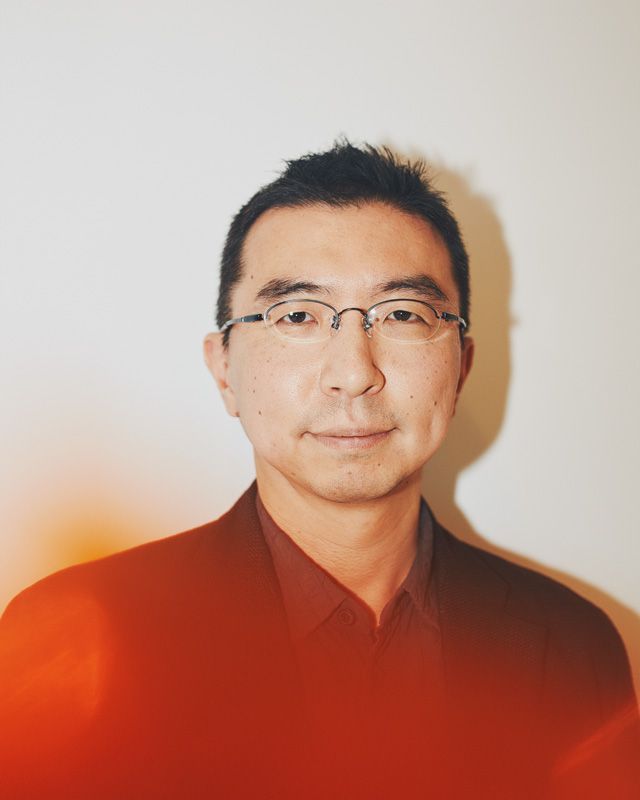SZ-Magazin: Besitzen Sie nocheinen Tisch?
Sou Fujimoto: In meinem Büro in Tokio habe ich keinen Tisch, nein.
Und zu Hause?
Dort schon. Meine Frau und ich wohnen in einer normalen, typisch japanischen Wohnung. Im neunten Stock. Drei Zimmer, fünfzig Quadratmeter. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer mit Esstisch. Ganz klassisch.
Das wundert uns. In den Häusern, die Sie entwerfen, fehlen nicht nur Wände. Es gibt auch kaum Möbel. Sitzgelegenheiten oder eben Tische sind oft Teil des Gebäudes.
Das stimmt. Ich entwerfe gern Wohnräume für andere. Aber nicht für mich selbst.
Warum denn nicht?
Das wäre eine unendliche Geschichte: Ich würde nur noch an meinem eigenen Haus arbeiten. Jeden Tag hätte ich eine neue Idee. Das wäre schrecklich. Da bleibe ich lieber in einer Durchschnittswohnung.
Könnten Sie sich denn vorstellen, in einem Ihrer Häuser zu leben?
Lassen Sie mich überlegen … Ja, doch. Am liebsten wäre es mir, abwechselnd in all den Häusern zu leben, die ich entworfen habe. In jedem steckt etwas, das ich liebe.
Welches mögen Sie am liebsten?
»House N« und »House NA« sind auf jeden Fall meine Favoriten. Wobei »House N« komfortabler ist. »House NA« wäre mir persönlich etwas zu offen, zu transparent. Dort sind ja alle Wände aus Glas.
Sie sagen »zu offen«. Warum haben Sie es so radikal geöffnet?
Das war der Wunsch des Kunden. Bis zuletzt habe ich gefragt: Sind Sie sich wirklich sicher? Man wird alles sehen können! Aber er sagte: Es ist perfekt! Die Grundidee dieser verschachtelten, terrassenartig aufgebauten Etagen kam natürlich von mir. Wir hatten sehr wenig Platz, das Grundstück liegt mitten in Tokio. So kam der Gedanke, die Enge durch gläserne Wände aufzubrechen. Die Kunden sagen, dass sie sich, obwohl sie in der Stadt leben, nun der Natur viel näher fühlen, da sie immer den Himmel sehen können.
Wer lebt in diesen Häusern?
In »House N« lebt ein älteres Ehepaar. Das Haus ist barrierefrei. Das Paar in »House NA« ist Anfang vierzig, kinderlos. Ein Arbeiter und eine Angestellte.
Man muss nicht reich sein, um ein Fujimoto-Haus bauen zu lassen?
Nicht superreich. Meine Wohnhäuser kosten zwischen 200 000 und 400 000 Euro. Ich hoffe natürlich, dass meine Preise bald steigen. Oder die Häuser zumindest größer werden. Wir realisieren jetzt in Montpellier ein Wohnhaus mit hundert Apartments, fünfzig Meter hoch. In Budapest haben wir gerade den Zuschlag für ein Musikmuseum bekommen. Wir arbeiten derzeit an etwa zwanzig Projekten weltweit.
Fahren Sie manchmal zu einem Ihrer ungewöhnlichen Häuser, um zu sehen, wie es sich darin lebt?
Regelmäßig. Die Häuser sind ja so offen, dass ich von außen sehen kann, wie sich die Bewohner eingerichtet haben. Man wird in diesen Häusern von vielen Passanten beobachtet. Die Leute bleiben stehen und gucken.
Sind Ihre Kunden Exhibitionisten?
Sagen wir es so: Sie stören sich nicht daran, gesehen zu werden. Aber sie haben auch Vorhänge, keine schweren, sondern weiße, lichtdurchlässige. Mit diesen lässt sich auch der wandlose Wohnraum teilen, frei gestalten. Sie erfinden ihr Haus jeden Tag neu. Das finde ich fantastisch.
Wie fühlt sich das Leben an in einem Vorhanghaus?
Das Gefühl, das man in diesen Häusern hat, lässt sich nach Lust und Laune verändern. Sie ziehen alle Vorhänge auf, und das kleine Haus erscheint grenzenlos, Sie sind frei. Sie ziehen die Vorhänge zu – und haben Ruhe zum Arbeiten oder Schlafen, und Sie fühlen sich behütet.
Sie propagieren also doch nicht das wandlose Leben?
Selbst wenn es nicht so aussieht: Ich mag Wände, gute Wände. Früher waren Wände da, um zu trennen. Aber eine Wand kann auch verbinden. Eine Wand kann Menschen auch zusammenbringen. Eine Wand kann etwas Schönes sein.
Wie sieht so eine neue Wand aus?
Nehmen Sie »House N«: Es ist nach einem Schachtelsystem aufgebaut. Eine kleine Schachtel steht in einer größeren, die wiederum in der größten Schachtel steht. Die Wände dieser Schachteln haben Fenster, Lücken und Öffnungen, man kann aus manchen Winkeln von außen durch das ganze Haus schauen. Von innen gesehen, bestehen die Wände aus Himmel, Garten, aus Distanz.
Eine Wand aus Himmel?
Warum sollte eine Wand immer aus Beton sein? Es geht in der Architektur darum, wie man das Außen vom Innen trennt. Mich reizt es, zu überlegen, ob es eine physische Wand braucht, ob man nicht auch aus Raum und Blick Wände errichten kann. Ich will auch Mauern aus Luft bauen.
Sollen Wände nicht Schutz bieten?
Absolut. Es braucht einen Ausgleich zu dieser Offenheit. Die drei Schachteln von »House N« sind deswegen ein gutes Beispiel: Ja, man kann aus manchen Winkeln durch das ganze Haus schauen – aus anderen aber eben nicht. Ich schaffe mit meinen Häusern ein neues Angebot. Früher war der einzige Kompromiss zwischen Innen und Außen das Fenster. In meinen Häusern gibt es mehr Kompromisse. Man hat in meinen Häusern die Wahl.
Sie verändern nicht nur das Verhältnis zwischen Innen und Außen, sondern auch das zwischen den Bewohnern Ihrer Häuser. Man kommt einander zwangsläufig nah.
Meine Kunden sagen, dass die Häuser ihre Beziehungen verändert haben. Das ältere Paar in »House N« ist seit vierzig Jahren zusammen, sie wollten gar keine Wände mehr, sie empfinden ihren Wohnraum nun als ebenso intim wie ihre Ehe. Für das jüngere Paar in »House NA« wollte ich Abstufungen schaffen. Es gibt in keinem Raum eine geschlossene Wand, aber je nachdem, ob die Bewohner stehen oder liegen, können sie für den anderen unsichtbar werden. Selbst wenn sie einander nicht sehen, spüren sie die Anwesenheit des anderen. Wenn der eine im Bett liegt, hört der andere in der Küche dessen Atmen – das Klappern der Töpfe ist zugleich aber so weit weg, dass es beim Einschlafen nicht stört. Dieses Spiel aus Nähe und Distanz macht die Beziehung vielseitiger.
»Es muss in meinen Häusern beides möglich sein: Abgeschiedenheit und Gemeinsamkeit.«

Könnten Sie sich so ein Zusammenleben mit Ihrer Frau vorstellen?
Noch nicht. Wir sind zehn Jahre zusammen und leben bereits auf engem Raum. Aber die Wände wegzulassen, würde ich mich erst später trauen. Vielleicht wenn wir Kinder haben.
Sie glauben, dass man als Familie ohne Wände leben kann?
Oh ja. Ich habe zwei offene Häuser für Familien entworfen. Selbst die Schlafzimmer sind nicht komplett abgetrennt. Jetzt sind die Kinder in die Pubertät gekommen, und ich dachte, es würde schwer, aber die Familien haben eine so gute Mischung aus Miteinander und Privatsphäre gefunden, dass sie nach wie vor glücklich sind. Auch die Kinder. Ich denke, durch das offene Zusammenleben haben sie erst recht gelernt, einander zu respektieren. Das fasziniert mich. Gerade, weil ich es aus meiner Jugend ganz anders kenne. Ich war froh, die Tür zu meinem Zimmer schließen zu können.
Wie sind Sie aufgewachsen?
Auf der Insel Hokkaido, sehr ländlich. Wir lebten in einem unspektakulären Haus inmitten spektakulärer Natur. Wenn ich aus dem Fenster blickte, sah ich nur Bäume und Wiesen. Wir waren zu fünft, meine Eltern, ich und meine zwei Brüder, einer älter, einer jünger. Als ich auf die weiterführende Schule ging, bekam ich mein eigenes Zimmer.
Wenn die Kinder, die in Ihren Häusern aufwachsen, keine Sehnsucht nach einem eigenen Zimmer haben: Ist der Drang nach Abgrenzung gar nicht natürlich, sondern erlernt?
Ich bin schon der Meinung, dass es ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, auch mal für sich zu sein und ganz beschützt. Wir kommen schließlich aus dem Mutterleib. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind liebte, mich zum Spielen in einen Pappkarton zu setzen. Ich war für mich, aber durch die Öffnungen sah und hörte ich meine Familie. Ich hatte meine Ruhe und war doch mittendrin. Diese Erinnerung beeinflusst mich bei der Arbeit. Es muss in meinen Häusern beides möglich sein: Abgeschiedenheit und Gemeinsamkeit.
Wann wussten Sie, dass Sie Architekt werden wollten?
Das ist gar nicht lange her. In den ersten zwei Jahren auf der Uni musste ich mich nicht für ein Fach entscheiden. Ich wollte eigentlich Physiker werden, ich liebte Einstein und wollte wie er die Welt verstehen und verändern. Leider merkte ich schnell, dass ich nicht gut genug war. Ich zeichnete gerne, also habe ich einen Architekturkurs besucht. Zuvor hatte mich Architektur nicht interessiert.
Warum nicht?
Ich hatte einfach keine Ahnung. Ich kannte nur Antoni Gaudí. Erst als ich an der Universität Le Corbusier und Ludwig Mies van der Rohe kennenlernte, verstand ich, dass sie zur selben Zeit wie Einstein die Art, wie wir die Welt sehen, verändert hatten.
Le Corbusier und van der Rohe bauten radikal andere Häuser in einer sich radikal wandelnden Zeit. Kann man sagen, dass Ihre wandlosen Häuser die Symbole des heutigen gläsernen Zeitalters sind?
Sie haben schon recht: Netzwerke wie Facebook haben das Verhältnis zwischen Privatheit und Öffentlichkeit verändert, ähnlich wie meine Häuser. Und sicher bin ich als Architekt von unserer Zeit geprägt. Aber diese Themen sind mir zu groß. Ich konzentriere mich einfach auf die Bedürfnisse der Menschen, für die ich Häuser entwickle. Ich nehme mir nicht vor, etwas Revolutionäres zu bauen. Das Wohnhaus in Montpellier wird ungewöhnlich viele ungewöhnlich große Balkone haben. Das ist revolutionär, basiert aber auf dem traditionellen Leben der Menschen in Südfrankreich: Ihr Leben fand immer schon zur Hälfte vor dem Haus statt.
Sie sagen, Sie bauen Häuser nach den Bedürfnissen der Menschen. Aber wie passt dazu Ihre gläserne Toilette in Ichihara?
Die Bezeichnung »öffentliche Toilette« ist ja ein Widerspruch in sich, eine Toilette soll doch privat sein. Damit habe ich gespielt, nachdem ich gefragt worden war, ob ich sie entwerfen möchte. Die Toilette hat Glaswände, steht aber in einem großzügigen Garten, der von einem Zaun umgeben ist. So sitzt man inmitten der Natur und kann doch nicht gesehen werden.
Japaner, so scheint es, haben eine spezielle Beziehung zu Toiletten: beheizte Sitze, Duschfunktionen, Föhns und so weiter.
Das ist lustig. Wir möchten eben auch diesen Teil des Lebens unbedingt schöner gestalten, daran arbeiten wir. Wie in allen Bereichen des Alltags. Stück für Stück. So sind wir eben.
Sie auch?
Ich bin ein bisschen anders. Es ist in Japan üblich, Dinge langsam zu verbessern, Millimeter für Millimeter. Aber Leute wie ich möchten auch mal einen Sprung machen. Das führt zu Konflikten. 99 Prozent der Japaner wollen sicher kein Haus von mir haben.
Wundert Sie das?
Nein. Meine Häuser sind eben das Gegenteil der normalen Mietshäuser, wie auch ich eines bewohne. Niemand in Tokio findet diese Wohnkästen schön. Aber die Leute sagen: Alle anderen wohnen doch auch so, also ist es gut. Das ist die japanische Mentalität.
Japan diskutiert seit Jahren das Phänomen »Hikikomori«: Immer mehr Menschen meiden Kontakte, ziehen sich zurück, schließen sich weg.
Ja, alle suchen das Private. Verstecken sich hinter Mauern. Gerade die Jungen vereinsamen aus Angst. Vor hundert Jahren war unsere Gesellschaft offener. Wir hatten keine starken Wände, alles war aus Holz und Papier.
Wie erklären Sie sich diesen Rückzug der Menschen?
In Japan ist es wie in einem kleinen Dorf. Die Leute schauen genau, was du tust. Leute wie mich würden sie am liebsten rausschmeißen aus diesem Dorf. Naja, ich meine, in Tokio geht’s, da gibt es noch andere Verrückte, aber sonst: Sie beobachten und kontrollieren dich, man kann nicht atmen, deshalb zieht sich jeder zurück, schützt sich. Und so kommunizieren wir weniger, es führt zur Isolation. Wir müssen wieder einen Mittelweg finden. Wir müssen aufeinander zugehen und einander gleichzeitig mehr in Ruhe lassen.
Sind Ihre Häuser also politisch? Eine Art Gegenbewegung?
Na klar, Wände aus Glas sind im modernen Japan ein starkes Symbol. Eine Provokation. Ich wäre stolz, wenn ich ein bisschen mithelfen könnte, unsere Gesellschaft offener zu gestalten. Wissen Sie, am liebsten würde ich eine Stadt bauen, zumindest eine Kleinstadt.
Eine Stadt?
Eine Stadt ist nicht nur Architektur, sie ist Leben. Sie hat alles: Straßen, Brücken, einen zentralen Platz. Als Architekt kannst du nur Gebäude bauen, aber nie eine Straße. Dabei ist doch die Straße das Aufregendste und Wichtigste. Dort begegnen sich die Menschen. Mit einer Stadt könnte ich den Grenzen der Architektur entkommen. Was ändert schon ein gläsernes Haus, wenn es von Sichtbeton umgeben ist? Das wäre wirklich mein Traum: Eine ganze Stadt bauen, die Menschen dabei hilft, Beziehungen zu knüpfen.
(Architektur-Fotos: Iwan Baan)
Fotos: Julian Baumann