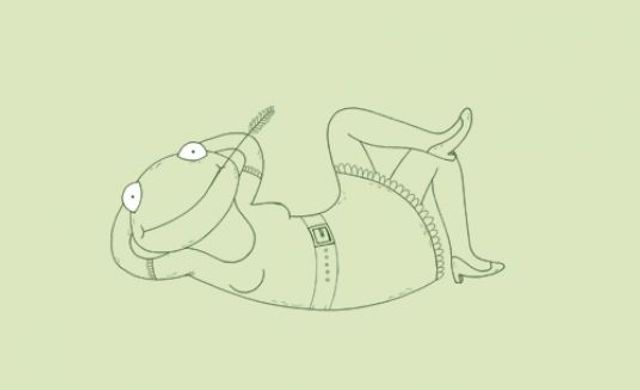Liebe Susanne,
wie es mir geht, fragst Du? Ich glaube, keine Frage macht mir derzeit, nach neun Monaten, so viel Kopfzerbrechen wie diese. Die kurze Antwort – die für alle anderen – lautet: großartig. Sensationell. Wie auch anders bei so viel unverschämtem Glück? Eine halbe Million beim Jauch gewonnen! Ein ganzes Jahr auf Weltreise unterwegs, jeden Monat in einer anderen Stadt! Besser geht’s nicht – das ist der Jackpot, auf den wir alle ein Leben lang warten, die meisten vergeblich.
Aber Du bekommst die lange Antwort, und die dauert ein bisschen. Ich erzähle Dir mal zwei Szenen, beide aus Hawaii, dann weißt Du, was ich meine. Szene 1: Ich hatte den Vormittag in der Villa von Doris Duke verbracht, einer Millionenerbin und Kunstsammlerin, die sich in den Dreißigerjahren an einer der schönsten Ecken der Insel Oahu niedergelassen hatte, umgeben von einer spektakulären Sammlung islamischer Kunst. Ihr Haus nannte sie »Shangri La« – und so war es auch. Ich bin quasi auf Knien durch die Räume gerobbt, es war überwältigend schön. Dann saß ich im Café der Honolulu Academy of Arts unter Bäumen, blätterte immer noch hingerissen und dankbar in einem Buch über »Shangri La«, aß Mahi-Mahi mit Sobanudeln und trank ein Glas Weißwein (am helllichten Tag!). Eine Kellnerin blieb vor meinem Tisch stehen, guckte mich an und sagte: »I’d like to be you.« Und ich dachte: aber selbstverständlich. Wer sonst sollte man sein wollen? Kann es ein besseres Leben geben?
Szene 2, kurz vor meiner Weiterreise nach San Francisco. Ich gehe in aller Herrgottsfrühe den menschenleeren Strand von Hunakai entlang. In der Ferne sehe ich einen Mann an der Flutkante stehen, zu seinen Füßen einen Retriever, er guckt aufs Meer, er steht ganz still. Ich passiere ihn nickend, er nickt zurück. Eine Viertelstunde später, auf dem Rückweg, sehe ich ihn immer noch da stehen, immer noch aufs Meer schauend. Und ich stelle mir vor: Der kommt jeden Tag hierher, er hat bestimmt ein Haus in der Nähe. Er geht jetzt heim und frühstückt im Garten. Abends geht er noch mal mit dem Hund raus, wieder hierher. Der hat ein richtiges Leben, denke ich, und ich bin überall nur auf der Durchreise, ohne irgendwohin zu gehören. Ich bin jetzt fünf Monate unterwegs, Sydney, Buenos Aires, Mumbai, Shanghai, Honolulu – ein Traum. Und plötzlich ein Albtraum. Ich gehe an ihm vorbei und sage ihm dasselbe, was mir die Kellnerin gesagt hat: »I’d like to be you.« Er guckt verwirrt, sagt aber »Thank you«, als ob er genau weiß, was ich meine.
Und jetzt frage ich Dich, Susanne: Bitte, wie kann das sein? Dass ich selbst im schönsten, begehrenswertesten Leben der Welt immer mal wieder Sehnsucht nach einem ganz anderen habe? Bin nur ich so? Sind wir alle so? Kommt man nie aus dem Wünschen heraus, nicht mal unter Palmen? Das ist doch zum Verzweifeln.
Ich komme nur darauf, weil Du mich fragtest, ob mir was zu Eurem Heftthema »Das gute Leben« einfällt. Ich kann Dir sagen: Dies ist das beste Leben, das ich je hatte. Aber ist es auch ein gutes? Oder vielleicht sollte ich besser fragen: Bin ich gut genug dafür? Ich erinnere mich noch genau daran, dass ich nach der Aufzeichnung der Wer wird Millionär?-Sendung wie betäubt auf dem Hotelbett saß und meine beste Freundin Katharina, die als Begleitperson dabei war, immer nur fragte: »Was mache ich jetzt bloß? Was will das Geld von mir?« Sie sagte das Einzige, was man in so einer Situation sagen kann: »Wir gehen erst mal Spaghetti essen. Der Rest ergibt sich.« Es war fast eine Bürde, das Richtige mit diesem Glücksfall anzufangen. Eine Reise, natürlich. Eine einjährige Auszeit. Freiheit! Abenteuer! Alle klopften mir auf die Schulter und sagten, es werde das beste Jahr meines Lebens. Und dann saß ich im Januar in Sydney und fühlte mich wie ein Zootier, das ausgewildert werden soll, aber nicht raus will aus seiner Transportkiste da in der Savanne. Eine Freundin schrieb tröstend: »Jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne.« Mag sein. Komisch trotzdem, dass wir uns auch mit dem Anfangen von Glück so schwer tun.
Hattest Du je im Leben eine längere Zeit ganz für Dich allein, in der Du tun und lassen konntest, was Du wolltest? In der Du nicht das Gefühl hattest, funktionieren zu müssen? Ich sage Dir, es ist furchteinflößend. Es hat eine Weile gedauert, bis ich sozusagen freihändig laufen konnte – das Funktionierenmüssen ist ja nicht nur ein Gehege, sondern auch ein Geländer, an dem man sich entlanghangeln kann. Glaub mir: Freiheit ist erst mal eine Zumutung. Keiner von uns hat gelernt, wie das geht. Oder wir haben es verlernt. Vor vielen Jahren, mit sechs, bei der Überreichung unseres ersten Stundenplans.
Also: Was fängt man mit sich an in so einem Jahr der totalen Freiheit? Welche Spielregeln gibt man dem Leben fern jeder Sozialkontrolle? Wie füllt man die Tage, wie hält man sich davon ab zu verwahrlosen, gar nicht erst aufzustehen, nachmittags die erste Flasche Rotwein zu entkorken – ist egal, guckt ja keiner? Die Antwort ist: indem man genau das erst mal tut. Und dann feststellt, dass es super ist. Für ziemlich genau drei Tage. Danach macht es keinen Spaß mehr, zumindest mir nicht.
Ich habe schnell gemerkt: Das gute Leben, das für mich gute Leben, ist nichts anderes als eine Exportversion meines Lebens zu Hause. Ich arbeite weiter, das weißt Du ja, oft mehr, als mir lieb ist – nur steht mein Schreibtisch jetzt halt jeden Monat in einer anderen Stadt. Ich mache im Wesentlichen dasselbe wie zu Hause – schreiben, lesen, essen, Leute treffen –, aber dadurch, dass ich es an immer neuen Orten tue, wird es immer wieder anders. Ich lese viel; ich lerne, was ich schon immer lernen wollte: Spanisch in Buenos Aires, Ukulele auf Hawaii, Tauchen in Israel. Die Welt, meine Fernuniversität.
»Meine Vorgeschichte ist uninteressant, es kommt auf andere Dinge an: Bin ich freundlich, offen, mutig, anständig?«
Dieses Ausprobierenkönnen, das ja das Leitmotiv dieses Jahres ist – zwölf Städte in zwölf Monaten –, empfinde ich ohnehin als das größte Geschenk. Ungebremste Neugier in alle Richtungen auszutoben, einfach stromern gehen zu dürfen, offen für Überraschungen und Erschütterungen zu sein, nicht immer schon vorher alles wissen zu müssen, wie ich es mir in den letzten Jahrzehnten mit immer geringer werdender Fehlertoleranz antrainiert habe – na sicher, all das hätte ich auch zu Hause haben können. Aber meine Versuchsanordnung macht die Sache um einiges spannender: In zwölf verschiedene Reagenzgläser getunkt zu werden sorgt für unberechenbare Reaktionen. In Buenos Aires war ich ungewohnt verfressen und genusssüchtig, in Shanghai berauscht vom Tempo der Stadt, in Honolulu lethargisch. In San Francisco und London hatte ich alle Antennen weit ausgefahren und war empfänglich für die seltsamsten Koinzidenzen und Synchronizitäten; ich fühlte mich fast überschüttet von Ideen, Erkenntnissen, Querverbindungen. Auf einer Weltreise wird man zu einer Zusammenhangsmaschine. Man klöppelt die entferntesten Orte, Zeiten und Personen zu einem schönen dichten Netz zusammen und lässt sich hineinfallen wie in eine Hängematte.
Du fragst, ob ich mich nicht manchmal allein fühle. Ja, manchmal. Aber selten. Und nicht alleiner als zu Hause, eher im Gegenteil. Denn zu Hause sind Beziehungen aller Art oft wacklige Konstrukte aus alten Gewohnheiten und stumm ertragenen Abhängigkeiten, ein ständiges gegenseitiges Aufrechnen, wer wem was schuldet. Hier draußen wird es wieder ganz einfach. Ich kann es nicht anders beschreiben als: Ich lebe im Präsens und im Indikativ. Meine Vorgeschichte ist uninteressant, es kommt auf andere Dinge an: Bin ich freundlich, bin ich offen, mutig, anständig, weiß ich mich zurechtzufinden? Ich habe wieder gelernt zu fragen, ohne die Antwort schon zu wissen zu glauben, ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten, und bin wieder und wieder gerührt von der Freundlichkeit Wildfremder. Und von der Leichtigkeit, mit der sich neue Verbindungen knüpfen. Wenn ich mich auf eins verlassen kann in diesem Jahr, dann auf diesen ewigen Reigen des Weiterreichens und Weitergereichtwerdens. Ich bin gut aufgehoben hier draußen.
Und danach? Ganz ehrlich: keine Ahnung, es ist noch viel zu früh. Ich habe noch ein Vierteljahr vor mir, Tel Aviv, Addis Abeba, Havanna – da kann (und wird) viel passieren. Jeder Monat mehr kann das Spiel noch mal völlig verändern. Wovor ich komischerweise keine Angst habe: dass dieses Jahr der Höhepunkt meines Lebens sein könnte. Fast im Gegenteil: Die Reise hat mir den Blick geweitet für all die Optionen, die ich habe. Ich habe festgestellt, dass ich mich in vielen Städten wohlfühle, dass ich beinahe überall leben kann. Ich habe unterwegs erstaunlich viele Menschen kennengelernt, die mitten im Leben ganz neue Karrieren begonnen haben, die was gewagt und viel gewonnen haben. Ich sage nicht, dass ich es auch tue, aber das Wissen, dass ich es könnte, macht mich froh und frei. Mein Gott, was alles ginge! Was für ein Glück, so viele Möglichkeiten zu haben, was für ein Reichtum! In San Francisco habe ich einen Tag mit der Freundin einer Bekannten verbracht, einer Psychoanalytikerin, die mit sechzig beschlossen hat, Kunst zu studieren. Abends beim Essen zitierte sie eine Gedichtzeile von Mary Oliver: »Tell me, what is it you plan to do/With your one wild and precious life?« Eine verdammt gute Frage, die ich mir jetzt ebenfalls neu stelle. Das Tolle ist doch, Susanne: Du darfst bis ans Ende deines Lebens immer wieder andere Antworten darauf geben.
Verändert mich dieses Jahr also? Nicht fundamental, nein. Aber es fördert ein paar verschüttete Dinge zutage, glaube ich. Es stellt einiges Verschwommene scharf. Das Hamsterrad, aus dem ich so froh war auszusteigen für ein Jahr? Das habe ich mir selbst zusammengelötet, es ohne fremde Hilfe bestiegen und mit allen Kräften in Gang gehalten. Ich habe wie wir alle oft gestöhnt über all die To-Dos: Blödsinn. Man muss so viel weniger, als man sich eingesteht. Ehrlicher wäre gewesen, ich hätte gesagt: Ich will. Ich hatte mich für das Hamsterradleben entschieden. Und sollte ich in das Rad zurückkehren, dann bewusst und ohne Murren.
Aber weißt Du, was das für mich Unfassbarste ist? Ich hätte die ganze Zeit tun können, was ich jetzt tue. Es kostet hier draußen nicht mehr Geld als zu Hause, oft weniger, und ich verdiene ja was. Ohne den Gewinn im Rücken hätte ich die Reise in meiner Betriebsblindheit nicht mal ansatzweise in Erwägung gezogen, und jetzt stelle ich fest: Ich hätte das Geld gar nicht gebraucht. Ich hätte jederzeit losziehen können, ich hatte es immer selbst in der Hand. Eine Lehre fürs Leben: sich mehr trauen. Es einfach machen, ohne viel nachzudenken – mit anderen Worten: ohne die üblichen Bedenken.
Deshalb war es auch gut, mich ohne jede Planung, Hals über Kopf in dieses Abenteuer gestürzt zu haben. Ich hatte nur wenige Erwartungen und erlebe deshalb auch keine Enttäuschungen. Hätte ich die Chance gehabt, alles penibel vorzubereiten – ich wäre nicht halb so weit gekommen. Und das Heimweh? Die Momente wie den am Strand von Hawaii? Vielleicht können wir wirklich nicht anders, als die Alternative immer mitzudenken, egal wie glücklich wir gerade sind. Aber wenn ich die Wahl zwischen Fernweh und Heimweh habe, wähle ich das Heimweh und fahre weiter um die Welt. Liebe Grüße an alle zu Hause, Deine Meike
Noch mehr Neuigkeiten von Meike Winnemuths Reisen lesen Sie in Ihrem Blog vormirdiewelt.de
Aufträge, die auf Ihrer Reiseroute liegen, nimmt sie unter meikes.reisebuero@sz-magazin.de entgegen.
Illustration: Dirk Schmidt