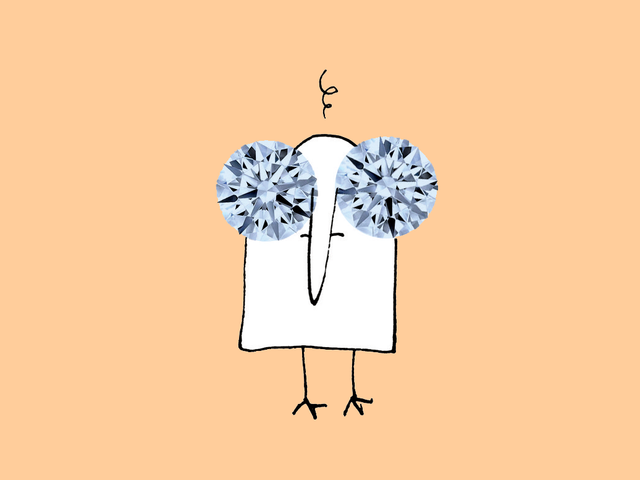An einem Sonntag vor etwa 18 Jahren stand ich mit einer Gruppe jüdischer Jugendlicher auf dem Bahnsteig einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Wir warteten auf den Zug nach Frankfurt am Main, von dort aus würden wir in unsere jeweiligen Heimatstädte weiterfahren. Wir kamen von einem Seminar über Jugendarbeit, ausgerichtet vom Zentralrat der Juden, da wir alle wenige Jahre später Jugendliche in jüdischen Ferienlagern in Deutschland und Italien betreuen wollten. Ich erinnere mich heute noch genau an jenen Sonntag vor 18 Jahren. Und das hat mit einer Gruppe von Jugendlichen aus der Kleinstadt zu tun, die uns ansprach, während wir Cola tranken, kicherten und quatschten.
Sie gingen direkt auf einige der Jungs zu, die Kippa trugen, pöbelten herum und taten zum Spaß so, als seien sie Nazioffiziere, die uns Juden in Waggons sperren würden. Sie brüllten laut »Männer nach links, Frauen nach rechts«. Sie bauten sich vor unserem Seminarleiter auf, um seine Größe zu messen - um zu sehen, ob er »in den Ofen« passen würde. Ich stand etwas abseits mit Freundinnen und schaute gleichermaßen erschrocken und wütend zu. Doch instinktiv, noch bevor ich daran dachte, zur Polizei zu gehen, wollte ich mich einmischen. Ich wollte mit diesen Jungs reden, die uns da auslachten. Ich wollte sie zur Vernunft bringen. Ich war 14 und konnte mir nicht vorstellen, dass man solche Dinge sagen und tun könnte, wenn man eine Ahnung davon hätte, wie das damals wirklich abgelaufen war, als man die Juden in Züge sperrte. Wir wurden von den restlichen Betreuern zurückgehalten. Kurze Zeit später stiegen wir in den Zug. Freiwillig.
Nach diesem Ereignis wollte ich meinen Mund nicht mehr halten. Ich wollte mit Rechten und Nazis und Rechtsradikalen reden, mit Antisemiten, Antizionisten und Rassisten – mit allen, von denen ich meinte, dass ihnen ein Gespräch mit einer deutschen Jüdin die Augen öffnen könnte. Ich fing an zu reden, wenn sie in der Schule in der Raucherecke Judenwitze erzählten, und suchte auf Demonstrationen gegen Rechts jede Möglichkeit zum Dialog. Das ging natürlich nicht immer gut; oft wurde es laut und hässlich, aber immerhin: Wir redeten. Später engagierte ich mich im Studentenverband. Im Rahmen eines Aktionstags verteilten wir »für den Frieden« Orangen aus Israel an Passanten in der Kölner Innenstadt. Ich lächelte, wenn man mürrisch an mir vorbeilief und bot das Gespräch an, wenn Beleidigungen in meine Richtung gezischt wurden.
Meine Eltern haben mich in dem Bewusstsein erzogen, dass Reden immer die erste Option ist. Es machte mir sogar Spaß, auf Demokratiefeinde einzureden, und lange Zeit war ich überzeugt, dass meine Erfahrungen als Jüdin und mein persönliches Wissen über den Holocaust auch Rechtsradikale zum Nachdenken bewegen könnten. Durch diesen Dienst an der Demokratie fühlte ich mich kultiviert und moralisch überlegen. Dadurch konnte ich mich mit Begriffen wie Rechtsstaat, Meinungsfreiheit und Wertegemeinschaft schmücken. Ich befand mich in guter Gesellschaft: Freunde, Bekannte, mein Netzwerk in den Sozialen Medien, PolitikerInnen, die ich mochte, wir alle waren überzeugt davon, dass es unsere Bürgerpflicht war, mit Nazis zu reden.
»Das muss man aushalten können«, sagte ich mir, während ich Youtube-Clips von AfD-Politikern anschaute, die ihre als Meinung getarnten Parolen durch die Bierzelte in Mecklenburg-Vorpommern schmetterten, oder in Talkshows von sich gaben. Ich kannte es nicht anders: In Deutschland spricht man mit Nazis und Rassisten und Antisemiten. Auch nach Hoyerswerda, Mölln und Solingen, auch nach der Aufdeckung des NSU. Auch nach dem Mord an Walter Lübcke.
Aber musste ich das wirklich aushalten? Und musste ich mit diesen Menschen auch noch sprechen? Beim Blick zurück auf all die Versuche, rechte Verschwörungstheoretiker, Rassisten und Antisemiten zur Vernunft zu bringen, wurde mir klar, dass mein emotionaler Aufwand viel größer war als das Ergebnis. Es waren auch selten echte Gespräche. Mir ging es ja nicht darum, noch mehr rassistische Parolen und antisemitische Verschwörungstheorien zu hören, sondern darum, mein Gegenüber zu überzeugen. Doch Nazis lassen sich von außen nicht überzeugen, ihre Ideologie ist keinen Argumenten zugänglich, das macht sie so widerstandsfest. Die Erleuchtung muss schon von innen stattfinden – und in diesen Fällen übernimmt ein Verein wie EXIT-Deutschland, ein Aussteigerprogramm für Rechtsradikale.
Heute wird in Deutschland oft vom »neuen Antisemitismus« und »aufflammenden Rassismus« gesprochen. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren von Fremdenfeindlichkeit betroffen sind.
Hinzu kommt: Wenn es überhaupt zu so etwas wie einem Dialog kam zwischen mir und einem Rechtsradikalen, drehte sich dieser oft ums Thema »Schuldfrage«. Denn wenn junge Nazis nicht gerade den Holocaust relativieren oder leugnen, sind sie oft ganz wild darauf, dass Juden ihnen öffentlich die Schuld an der Schoa aberkennen - denn sie, die Jungen, könnten ja nichts dafür. Es kam tatsächlich vor, dass ich das Gespräch mit überzeugten, radikalen AfD-Wählern suchte, und sie erst von ihrer Verantwortung für den Holocaust freisprechen musste, bevor sie überhaupt bereit waren, mit mir zu reden. Ich finde diese Umkehrung der Verhältnisse symptomatisch für Rechtsradikale, Rechtspopulisten und Nazis. Weil eigene Inhalte und tatsächliche Lösungsansätze fehlen, wird der Dialog künstlich mit Empörung aufgehalten. Ich bin nicht (mehr) bereit dazu, die Gesprächsregeln dieser Verfassungsfeinde als meine anzuerkennen.
Heute wird in Deutschland oft vom »neuen Antisemitismus« und »aufflammenden Rassismus« gesprochen. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die seit Jahren von Fremdenfeindlichkeit betroffen sind. Deutsche Nazis sind kein neues Phänomen, Fremdenfeinde sind kein Resultat einer verfehlten Flüchtlingspolitik, Judenfeinde sind kein Resultat des bösen Finanzlobbyismus. Beides war immer Teil unserer Gesellschaft, und wir begegnen diesen Menschen immer noch und zu oft auf Augenhöhe, ob mit Argumenten, Fakten oder Orangen »für den Frieden«. Wer profitiert davon, dass es in Deutschland als Tugend gilt, das Gespräch mit ganz Rechts zu suchen? Es sind die ganz Rechten, die es dadurch immer wieder schaffen, den Dialog an sich zu reißen und die eigentlichen Themen – Integration, Rechtsterror, Demokratiefeindlichkeit – zu kapern und umzudeuten. Und häufig schafft es die Gesellschaft nicht einmal, zu benennen, was sie tut: So sitzen keine »Neonazis« in Polittalkshows, sondern »Europakritiker«, »Volksschützer«, »Asylgegner«. Sie haben halt ein Problem mit Flüchtlingen, der LGBTQ-Community, Juden, Muslimen, Schwarzen. Und mit Abtreibung. Denn sie alle lieben Föten.
Ich habe für mich entschieden: Ich sage kein Wort mehr zu Rechtsradikalen, ich suche den Dialog nicht mehr, ich mache den Fernseher aus, wenn sie sprechen, ich ignoriere die Kommentarspalten, in denen sie sich auskotzen. Vielleicht mag das für manche trotzig klingen, andere entgegnen, dass man die extreme Rechte nur stärker macht, wenn man nicht mit ihr spricht. Doch diesen Schuh brauchen wir uns nicht anziehen: Jedes Plenum, das man rechtextremer Ideologie bereitet, gibt ihr noch mehr Reichweite.
Uwe Junge, der angeblich moderate AfD-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, war am Montag bei Hart aber fair zu Gast. Vorangegangen war ein Shitstorm für die Tatsache, einen Politiker wie Junge zum Thema »rechter Terror« überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Frank Plasberg scheiterte an diesem Gast, er musste scheitern, weil sein Fokus auf fair, nicht auf hart lag. Es war dasselbe Bild wie in so vielen anderen Talkshows der letzten Monate. Überforderung bei Will, Maischberger und Lanz, deren Versagen im Umgang mit rechten Politikern nur noch peinlich ist. Schade um die Sendezeit, schade um das Honorar, mit dem man interessantere Menschen hätte zu Wort kommen lassen können.
Beim Ringen um die Deutungshoheit in dieser Debatte brauchen wir, die Demokraten, einen langen Atem. Wir sollten unsere Luft nicht mehr an Nazis verschwenden.