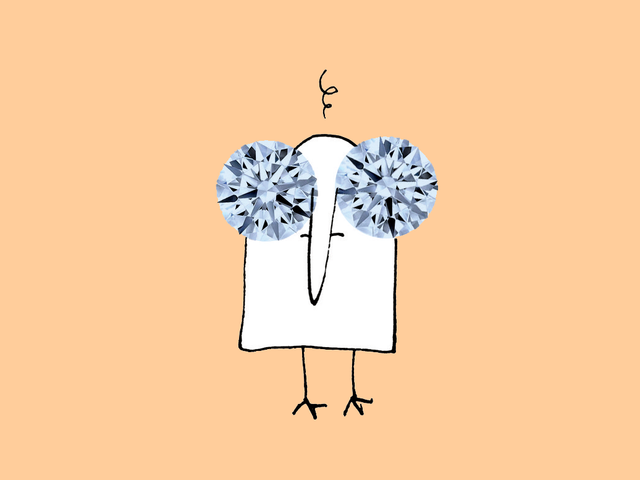Seit ich denken kann, schläft meine Mutter draußen. In der Stadt, auf dem Balkon ihrer Etagenwohnung. Nicht jede Nacht, um Himmels willen, aber: jeden Sommer. Wenn es trocken und warm ist und die sogenannte Lichtverschmutzung dem Firmament diesen charakteristisch matten Großstadtglanz verleiht, durch den nur die stärksten Sterne dringen. Als Kind dachte ich: Im Sommer draußen schlafen, das machen alle so. Als Jugendlicher dachte ich: Die Alte spinnt. Heute denke ich: Wie kriege ich die Gästematratze auf den Balkon, ohne dass meine Frau sagt, ich solle eine Plane unterlegen?
Drei Dinge muss ich gleich klarstellen: Erstens, es ist eine Tortur. Zweitens, es ist herrlich. Drittens: Wir reden über das Biwakieren, also das Übernachten unter freiem Himmel, ohne Zelt. Wobei zum Biwakieren eine Plane, eine Isomatte und ein Schlafsack empfohlen werden. Die Leute immer mit ihrer verdammten Plane! Das Wunderbare am Draußenschlafen ist eben nicht, dass es neue Ausrüstung aus Mikrofaser und Spezialgeschäften erfordert, sondern dass man draußen wie im eigenen Bett schläft, dass man also den normalen Bett- und Nachtalltag in etwas Besonderes verwandelt, aber mit denselben Utensilien.
So fing es bei meiner Mutter an, etwa 1979: Der Balkon vor unserer Wohnung in Berlin-Zehlendorf hatte in etwa die Maße einer Standardmatratze, knapp einen mal gut zwei Meter, und in meiner Erinnerung konnte meine Mutter gar nicht anders, als diesen Raum mit der Matratze zu füllen und sich mit ihrem Bettzeug zwischen die Blumenkästen zu legen. Die Wände des Balkons waren gemauert, sodass sie auf dem Balkon frei und geschützt zugleich war. Die Frage war also nicht, warum sie anfing, im Sommer hin und wieder draußen zu schlafen, sondern warum in aller Welt sie es nicht hätte tun sollen.
Das Bedürfnis, bei passender Witterung draußen zu schlafen, ist vermutlich so alt wie das Alltagsleben in festen Behausungen. Miguel de Cervantes beschrieb vor über 400 Jahren in einer Novelle, wie sich eine Nacht unter freiem Himmel anfühlt: »Wir sehen, wie die Morgenröte die Sterne des Himmels verdrängt und zertritt und mit ihrer Gefährtin, der Tagesdämmerung, emporsteigt, Freude in der Luft, Kühlung im Wasser und Feuchte auf der Erde verbreitend.« Nicht nur Feuchte auf der Erde, möchte man anfügen, aber bleiben wir erst mal bei »Freude in der Luft«, bei diesem Gefühl der Erhabenheit, das sich nachts ohne Dach einstellt, Freiheit, wie das Wort vom »freien Himmel« schon sagt. In Don Quijote schreibt Cervantes vom Bedürfnis, draußen zu schlafen »wie ein unvernünftiges Tier«, und trifft damit, was den Zauber ausmacht: die Unvernunft, die Grenzüberschreitung, die Abkehr vom Alltäglichen. Mutter, du unvernünftiges Tier! Diese Sehnsucht lebten vor allem die Schriftsteller der deutschen Romantik aus. Jean Paul preist in seinen Flegeljahren das Schlafen unter freiem Himmel: »Man braucht kein dumpfes Haus, jede Staude macht man sich zur Stube.« Ja, Stauden hatte es reichlich auf dem Balkon meiner Mutter. Und ist das »dumpfe Haus« nicht vielleicht einfach nur ein hin und wieder als dumpf empfundenes Leben, aus dem man nachts ins Freie flüchten möchte?
Der freie Himmel ist mir als Wert von den Eltern mitgegeben worden. Mein Vater bezeichnet es noch heute als seine Lieblingsbeschäftigung, auf dem Rücken im Gras zu liegen und in den Himmel zu schauen. Dies allerdings tagsüber, ein entscheidender Unterschied. Denn seit ich selbst angefangen habe, im Sommer gelegentlich draußen zu schlafen, muss ich sagen: Es ist nichts für Anfänger. Und es ist nichts für Leute, die etwas gegen einen feuchten Film auf der Bettdecke und gegen neugierige Insekten haben. Seht, sagen die Mücken, die Bewohner der dumpfen Häuser haben kapituliert und uns einen der ihren als Opfergabe hinausgeschoben. Let’s suck!
Es ist auch sehr laut, wenn man draußen schläft. Auf dem Balkon in der Stadt auf irritierend vertraute Weise, denn man meint, man läge zwischen dem eintreffenden Taxi und dem Bordstein, und irre, wie lange die Nachbarn draußen sitzen und sich über den Elternabend unterhalten! Auf dem Land wiederum ist es nachts draußen auf irritierend unvertraute Weise laut: Ist das ein Reh auf der Suche nach Knospen oder etwas, wovon ich niemals Gelegenheit haben werde zu erzählen? »Sleeping rough« nennen die Engländer es, wenn man gezwungen ist, draußen zu schlafen: grob schlafen. Grob und rau – so fühlt es sich auch an. Weil man eben doch nicht die gute Matratze mit rausgenommen hat, sondern eine gepolsterte Gartenliege, oder weil der Balkon ein bisschen abschüssig ist und nicht nur vom Mond beschienen wird, sondern auch von einer hartnäckigen Hausnummer gegenüber. Wie gesagt, es ist eine Tortur. Und ein Privileg, den Vorgang jederzeit abbrechen und wieder reingehen zu können. Biwakieren, der letzte Luxus der Behausten.
Das Wort »Biwak« kommt vom niederdeutschen »Beiwache«, und tatsächlich ist man dabei meistens wach. Vielleicht weil die Kinder, für die das ein großes Abenteuer ist und womöglich der Anfang einer lebenslangen Sehnsucht, einen nach Sternbildern fragen. Da, der große Wagen. Und der kleine Wagen. Äh, ja, Papa, welche kennst du noch? Es gesellen sich der große und der kleine Bär dazu, aber der berechtigte Verdacht, die beiden seien in Wahrheit mit den Wagen identisch, ist den Kindern nicht auszutreiben. Oder man genießt einfach das Gefühl, so klein und frierend und fremd in der Welt zu sein, ein Urzustand, den zu verdrängen man tagsüber tausend Mittel hat, nachts draußen aber kaum noch eins.
Das begleitet einen in den nächsten Tag, und das finde ich am schönsten am Draußenschlafen: dieses Gefühl, für eine Weile ein Fremder im eigenen Leben zu bleiben, übernächtigt, verspannt, erschöpft, aber so, als hätte ich was geleistet. Wenn die Draußennacht vorbei ist, sieht man sich selbst noch eine Weile wie von außen. Die Wände der Wohnung scheinen nicht mehr ganz so selbstverständlich, das Bett eine Idee zu weich. Und im Gespräch mit Kollegen denke ich: Ja, mag sein, dass du mir sagen kannst, ich solle das alles noch mal und ein bisschen anders machen – aber im Gegensatz zu dir habe ich vorige Nacht unter freiem Himmel gelegen, die Leere über und die im Lauf der Nacht immer härter werdende Liege unter mir, insofern macht mir das gar nichts.
Meine Mutter plant, in die Stadt zu ziehen, in der wir wohnen, damit ihre Enkel mehr von ihr haben. Ich begleitete sie zur Besichtigung einer Seniorenwohnung. »Sogar Südseite«, sagte die Leiterin der Einrichtung über den Balkon. Meine Mutter und ich haben ein gutes Augenmaß. Höchstens ein mal anderthalb Meter. Wir sahen uns an und schüttelten die Köpfe.
Foto: Ali Bosworth