Die Frau würde sterben, das wussten wir. Sie war seit fast dreißig Jahren zuckerkrank, seit sieben Jahren musste sie dreimal in der Woche an die künstliche Niere. Obwohl sie erst 61 Jahre alt war, sah sie schon aus wie achtzig. Diabetiker altern schnell, Dialysepatienten noch schneller. Vor vier Wochen hatte die Frau einen Herzinfarkt erlitten. Seitdem lag sie auf der Station, auf der ich als junger Assistenzarzt im ersten Ausbildungsjahr eingeteilt war. Es sah nicht gut aus für die Frau: Ihr drohte auch eine Blutvergiftung – über die Infusion in ihrer Halsvene und den Blasenkatheter konnte sie sich leicht infizieren.
Täglich bekam sie Besuch von ihrem Mann. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass die Frau, die ihm so nahestand, nicht mehr ansprechbar war. Hilfe suchend rief er auf dem Stationsflur hinter uns Ärzten her. »Herr Doktor, Herr Doktor, nur eine kurze Frage!« Wenn er einen von uns erwischt hatte, sagte er jedes Mal: »Warum? Sie hat doch den Zucker jetzt schon so lange. Warum nur?« Er fragte nach dem Warum, als glaubte er an einen göttlichen Strafkatalog oder einen tieferen Grund für das Sterben seiner Frau. Dumme Frage.

Uns, die wir an den besten Universitäten des Landes eine naturwissenschaftliche Ausbildung genossen hatten, war sonnenklar, was mit der Patientin geschah: jahrzehntelanger Diabetes mit schlecht eingestelltem Blutzucker. Logisch, dass irgendwann die Blutgefäße dichtmachten. DDD – dick, diabetisch, doof, das war die Einschätzung unseres Oberarztes für Patienten wie sie, die ihren Blutzucker nicht in den Griff bekamen. Die Dialyse gab den maroden Adern den Rest. Dass die Patientin über kurz oder lang einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen würde, war doch leicht einzusehen. »Warum?« Dumme Frage. Weil er es offenbar einfach nicht verstehen wollte und die Frage immer wieder stellte, begann uns der Mann lästig zu werden. Jeden Tag schien es so, als würde er auf uns lauern, um sich, sobald er einen wei-ßen Kittelzipfel sah, auf uns zu stürzen. Bald gab es ein Frühwarnsystem, wenn er auftauchte. Wir verkrochen uns im Stationszimmer oder gingen energischen Schrittes an ihm vorbei und sagten mit gespieltem Bedauern, dass wir zu einer dringenden Besprechung müssten.Zehn Tage ging das so, dann war die Patientin tot. Danach haben wir den Mann nie wieder gesehen.
Es ist offenbar schwer, sich angesichts all des Leidens, das man als Arzt aus nächster Nähe erfährt, das Gespür für die Nöte der Kranken zu bewahren. Nicht wenige angehende Mediziner machen eine seltsame Art der Verrohung durch, eine anschwellende Gefühllosigkeit: Aus dem idealistischen Novizen im Medizinstudium wird ein zynischer Assistenzarzt. Zu meiner Irritation erfuhr ich das schnell am eigenen Leib, nachdem ich nach Abschluss des Medizinstudiums als junger Assistenzarzt in der Klinik angefangen hatte. Anfangs eiferte ich großen Vorbildern nach, dachte an Ärzte, für die trotz aller Belastungen ein verständnisvoller Umgang mit Patienten das Wichtigste blieb. Nach wenigen Monaten erkannte ich mich kaum wieder.
Die Patientin war Mitte sechzig und wegen einer Thrombose der tiefen Beinvenen in unsere Klinik gekommen. Sie befand sich längst auf dem Weg der Besserung. Als junger Assistenzarzt war ich für sie zuständig. Sie hatte offenbar Vertrauen zu mir gefasst, denn sie fragte mich immer wieder, wie es um sie stehe. Wie auch an jenem Tag: Sie fühlte sich unwohl. Die Blutwerte und alle anderen Untersuchungsbefunde waren jedoch normal. Ihrer baldigen Entlassung stand demnach nichts im Wege. Als ich in ihrem Zimmer vorbeischaute, fragte sie mich: »Herr Doktor, muss ich sterben?«
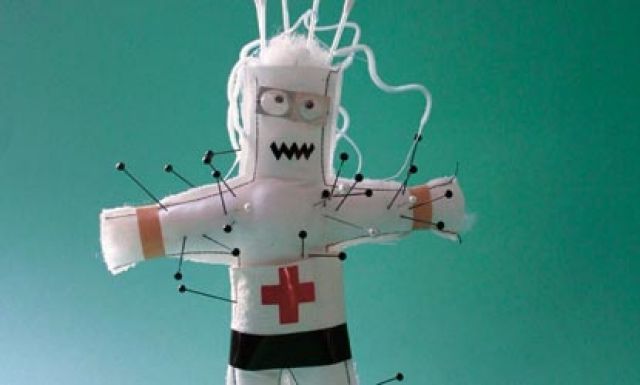
Sie war offensichtlich sehr aufgewühlt. Ich nahm das zur Kenntnis, sagte aber nur beiläufig: »Sterben müssen wir alle mal.« Das fand ich wohl cool und angesichts der unvorhersehbaren Schicksalsschläge in der Medizin auch angemessen.
Um Coolness geht es in der Medizin aber nie. Im Umgang mit Patienten kommt es auf Empfindsamkeit und Einfühlungsvermögen an. Wie leicht wäre es gewesen, mich an das Bett der Frau zu setzen, ihr ein paar tröstende Worte zu sagen und ihr die Zuversicht zu vermitteln, dass sie bald wieder nach Hause könnte. Stattdessen fertigte ich sie mit einem lakonischen Spruch ab.
Eine groteske Situation: Das schien nicht ich selbst zu sein, der so mit der Patientin umsprang. Und natürlich war ich es doch – zumindest der Teil von mir, den die Klinik zum Vorschein brachte. Ich befand mich auf dem besten Wege, unempfindlich zu werden gegenüber den Bedürfnissen der Kranken. Hatte ich früher alte Menschen gemocht, so wurden sie in der Klinik zur Bedrohung, weil sie ständig etwas forderten. Die Patienten begannen, mir lästig zu werden. Angehörige sowieso.
Ich sah die anderen Assistenzärzte um mich herum, sah die Oberärzte und Chefärzte, die sich zynisch gaben. Sie pflegten ihren Sarkasmus gegenüber Kollegen und Patienten, anstatt darüber zu reden, wie überfordert sie waren. Und machten schlechte Witze.
Ich wollte nicht abstumpfen wie viele andere Ärzte, ich wollte nicht reden wie sie. Mir kamen die Geschichten in den Sinn, die mir Freunde und Bekannte von ihren Begegnungen mit Ärzten erzählt hatten. Von der Gynäkologin, die nach der Untersuchung sagte: »Sie haben einen Beckenboden wie eine Hängematte.« Eine Kollegin hatte mir von ihrem Bruder erzählt, der mit hohem Fieber und starken Kopfschmerzen ins Krankenhaus kam. Diagnose: unklar. Nach vier Tagen reichte es der Mutter, sie fragte einen Assistenzarzt, was ihr Sohn denn nun habe. Der Medi-ziner sagte zu der verängstigten Mutter: »Hören Sie doch auf mit Ihren hormon-gesteuerten Fragen, dadurch wird es nicht besser.« Eine Patientin wiederum, die auf unserer Station lag, hatte mir von einem Besuch beim Rheumatologen erzählt. Als er ihre mit Krampfadern überzogenen Beine sah, sagte er: »Mein Gott, Sie haben ja Stampfer!«

Mir fielen meine Erfahrungen ein, die ich selbst als Patient mit Ärzten gemacht hatte, und die Erlebnisse, die mich während meiner Arztwerdung immer wieder irritiert, verstört und verletzt hatten: die Erniedrigung und Entwürdigung der Patienten, die fehlende Anteilnahme und das wenig ausgeprägte Mitgefühl. Das Unvermögen vieler Ärzte, hinter den geschilderten Beschwerden die wirklichen Notlagen der Kranken zu erkennen. Mich überkam eine leise Ahnung, dass ich diesen Beruf nicht mehr lange ausüben würde.Ein erster Grundstein für die Verrohung und Missachtung gegenüber den Patienten wird bereits im Medizinstudium gelegt. Im ersten Semester erklärte uns der Professor für Histologie in der Vorlesung: »Befahrene Wege müssen gepflastert sein.« Der Experte für Gewebeuntersuchung wollte damit sagen, dass in der Vagina und im Mund Gewebe vorkommt, das wie eine Pflastersteinstraße aussieht und Plattenepithel heißt.
In unserem Pathologiebuch, noch heute ein Standardlehrbuch, stand zu lesen: »Der einzige Reiz, den alte Männer haben, ist der Hustenreiz.« Als ich gegen Ende des Studiums die Möglichkeit zu einem Forschungsjahr in den USA hatte, brachte ein Oberarzt die feindliche Haltung vieler Mediziner gegenüber Patienten auf den Punkt: »Gehen Sie in die Forschung. Mit Kranken und Jammernden haben Sie später noch genug zu tun.«Die Bedürfnisse der Patienten zählen wenig in der Ausbildung zum Arzt. Im Medizinstudium werden Fächer wie Psychologie, Psychiatrie und Psychosomatik vernachlässigt. Sie nehmen im Stundenplan im Vergleich zu innerer Medizin, Chirurgie oder Orthopädie lächerlich wenig Platz ein. Von den Organmedizinern ist häufig Herab-lassung zu spüren, wenn es um psychische Probleme der Patienten geht. Im Kursus für innere Medizin hörten wir mehrfach von unseren Professoren: »Wenn ein Patient über Schmerzen oder andere Beschwerden in mehr als drei verschiedenen Körperregionen klagt, ist es psychisch.« Damit wollten unsere Dozenten, Chefärzte für innere Medizin, anscheinend sagen: Psychische Probleme – das ist nicht unser Bier.
Ein weitverbreitetes Ärzte-Bonmot lautet: »Die Medizin wäre eine schöne Disziplin, wenn nur die Kranken nicht wären.« Das ist mehr als nur ein Spruch, diese Haltung spiegelt sich auch im Karrierebild des idealen Mediziners wider: Belohnt und befördert wird eben nicht der Arzt, der sich einfühlsam um seine Patienten kümmert. Auch derjenige, der seine Patienten gründlich untersucht und die Krankengeschichte am sorgfältigsten erhebt, macht nicht unbedingt Karriere. Nicht einmal in den chirurgischen Fächern kommt derjenige weiter, der am besten operieren kann. Im Gegenteil, häufig werden ausgerechnet diejenigen Mediziner später Chefärzte, die ihre Zeit im Labor statt am Krankenbett verbracht haben und die aufgrund ihrer Operationsweise eher gefürchtet sind.
Im Studium lernen zukünftige Mediziner kaum, häufige Leiden zu behandeln. Im Vordergrund stehen seltene Syndrome, weil die Dozenten auf diese Weise zeigen können, wie pfiffig sie sind. Indem sie im Alltäglichen das Ausgefallene erkennen, erheben sie sich über Feld-Wald-und-Wiesen-Haus-ärzte, die nach Ansicht vieler Unimediziner ahnungslos und ignorant ihre Arbeit tun.Wie haben wir kurz vor dem Abschlussexamen an der Universität den Professor bewundert, der uns in einem Repetitorium den Fall eines vierjährigen Jungen schilderte, der zu seinem Kinderarzt in die Praxis gebracht wurde. Offenbar hatte der Kinderarzt übersehen, dass der Junge schon seit zwei Tagen kein Wasser mehr gelassen hatte.

Das ist in der Tat ein Versäumnis für einen Arzt. Der Junge litt an einer ziemlich seltenen Nierenerkrankung. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sich die Kinder matt fühlen, Bauchschmerzen bekommen und eben kein Wasser mehr lassen. Wenn ein niedergelassener Kinderarzt diese Diagnose einmal in fünf Jahren stellt, ist es schon viel, so selten ist sie. Unser Professor kam uns im Studium wie ein Held vor, als er den Fall schilderte. Wie ein Pionier der Medizin, der den tumben niedergelassenen Hausärzten endlich die Leviten las. Den Kinderarzt hielten wir für einen verachtenswerten Ignoranten, der eine glasklare Diagnose nicht erkannt hatte.
Das ist die Prägung, die viele Mediziner mit auf den Weg bekommen: die Feier des Abwegigen, Seltenen, das im Idealfall zu einem Fallbericht in einem Fachblatt taugt, weil es so einmalig ist. Dabei wäre das Gegenteil wichtig, denn zunehmend fällt es Ärzten schwer zu erkennen, ob jemand ernsthaft krank ist oder nicht, ob dringend medizinisch etwas unternommen werden sollte oder nicht. Dieser Blick für den Menschen fehlt vielen Medizinern.
Im Fall des Jungen wäre es sicher hilfreich gewesen, auf die seltene Diagnose zu kommen. In den meisten Fällen dagegen verstellt die Vorliebe für Raritäten den Blick auf das Alltägliche – auf das, was die Menschen beschäftigt, und auf das, was sie leiden lässt. Gegen Ende des Medizinstudiums war ich für einige Wochen bei dem Röntgenexperten eingeteilt, um Einblicke in das Fach zu bekommen. Eines Morgens kam eine Nonne in die Radiologie. Sie war Ende fünfzig, schlank und von auffallend aufrechtem Gang. Der Hausarzt hatte sie geschickt, weil sie gelegentlich Blut im Stuhl hatte.
Da dieses Symptom auf Darmkrebs hinweisen kann, sollte sie einen Dickdarmkontrasteinlauf bekommen. Eine harmlose Prozedur, aber auch eine extrem lästige: Zunächst muss dazu breiiges Kontrastmittel in den Enddarm eingeführt werden. Es sieht aus wie dickflüssige Milch. Damit sich das Mittel an den Wänden des Dickdarms verteilt, wird nach dem Brei noch Luft in den Darm gepumpt. Die Luft ist im Röntgenbild dunkel, das Kontrastmittel hell. Der Arzt hofft so zu erkennen, ob die Darmwand Wucherungen oder sonstige Auffälligkeiten aufweist.Die Nonne war mittlerweile bis auf das Unterhemd entkleidet. Sie stand vor uns und drehte sich verschämt ab. Für uns Mediziner war der Anblick nackter Menschen Routine. Die Nonne genierte sich jedoch sehr. Für sie war es nicht alltäglich, sondern entschieden außergewöhnlich, sich vor fremden Männern auszuziehen.
Der Radiologe führte das Endoskop in den Enddarm der Nonne ein, schob es vor und ließ Kontrastmittel in ihren Darm laufen. Immer wieder fragte er, ob es auszuhalten sei. Sie musste sich drehen, da passierte es: Der Nonne entfuhren ein paar Winde. Es war ihr unangenehm, sie wollte in den Boden versinken vor Scham.
Der Radiologe gab ihr ein viel zu kurzes Handtuch, das sie sich schnell um die Hüften wickelte. Es verdeckte ihren Po nur notdürftig. Er redete auf sie ein, dass diese Winde unangenehm seien, aber völlig normal und bei allen Patienten aufträten. Sie müsse sich nicht schämen. Allerdings tat der Radiologe nichts weiter, um ihre Blöße besser zu maskieren.
Die Nonne huschte über den Flur, auf dem noch andere Patienten standen. Sie hatte nur ihr Unterhemd an, an den Beinen sah man weiße Tropfspuren. Der Radiologe hatte die Nonne nicht absichtlich bloßgestellt. Doch da er täglich unzählige nackte Körper sah und Schläuche in Öffnungen schob, war ihm entgangen, dass das, was für ihn Routine war, bei vielen Menschen die Schamgrenze entschieden überschreitet. Ein größeres Tuch, ein Wandschirm, ein Blick zur Seite – das hätte der Nonne womöglich schon das Gefühl vermittelt, auch in ihrer Nacktheit und Verletzlichkeit respektiert zu werden.

Sie war weinend in der Untersuchungskabine verschwunden. Ich klopfte. Schluchzend hockte sie auf einem Stuhl und hatte sich schon wieder angezogen. Sie sah mich mit einer Wut an, die ich selten gesehen habe. »Ihr Unmenschen, ihr«, fauchte sie. Die Nonne ging, ohne ihre Röntgenbilder mitzunehmen. In ihrer Alltagsvergessenheit geht vielen Medizinern nicht nur das Gefühl für die Schamgrenze ihrer Patienten verloren, sondern auch für die Würde. Zugegeben, Fälle wie dieser, den ich nach gut zwei Jahren als Klinikarzt erlebt habe, sind selten. Schlimm genug, dass sie überhaupt vorkommen: Es handelte sich um eine 81-jährige Patientin, die im Sterben lag. Ihr Herz baute rapide ab. Ihr Luftholen ähnelte eher Abschiedsseufzern als Atemzügen.
Die wollten die Ärzte nicht sehen, jetzt nicht mehr. Schließlich würde sie sterben, das war klar. Warum sollte sie dann noch ein normales Krankenzimmer belegen? Besuch bekam sie ohnehin so gut wie nie. Einmal, aber das war drei Wochen her, war ein Nachbar da, der brachte Blumen und Konfekt mit. Er war dann aber doch zu erschrocken darüber, wie schlecht es seiner Bekannten ging, und kam nie wieder. Man beschloss, das Zimmer der Patientin zu räumen. Es herrschte ein unausgesprochener Konsens, dass man die Todkranke den Ärzten bei der täglichen Visite nicht länger zumuten konnte. Sie hätten einfach nichts mehr für sie tun können. Was sollte man an ihrem Bett besprechen? Was sollte der Chefarzt mit ihr machen, der wöchentlich zum Rundgang kam? Das war Vergeudung von Kompetenzen. Außerdem mochte der Chefarzt keine sterbenden Patienten. Heilen, lindern, helfen – das war sein Wahlspruch. Nicht: sterben lassen.
Schräg gegenüber unserem Arztzimmer gab es eine Art Abstellkammer. Der Verbandwagen wurde hier geparkt, zudem lagerten dort Reservepackungen mit Mullbinden. Der Fußboden bestand aus zerschlissenem Linoleum, das es in Patientenzimmern längst nicht mehr gab. Die Patientin wurde von den Schwestern in ihrem Bett am nächsten Tag in den Abstellraum verlegt. Sie schaute verzweifelt, als sie über den Gang geschoben wurde. Zumindest wirkte es so. In den letzten Tagen hatte sie immer wieder die Augen verdreht. Man konnte in ihren Gesichtsausdruck viel hineinlesen.
Diese Patientin war nicht mehr Teil des Berufsalltags auf der Station, die Ärzte standen nicht mehr ratlos an ihrem Bett herum. Die Patientin bekam weiter ihr Essen, wurde auf die Bettpfanne gesetzt, aber Schwestern wie Ärzte machten einen Bogen um die Kammer mit der Sterbenden. Vier Tage nachdem sie über den Gang in die Kammer geschoben worden war, war die Patientin tot. Am Tag darauf war wieder Chefvisite. Der Chef fragte: »Ist sie weg?«
Ja, jetzt war sie weg, endgültig.
Wenige Wochen später habe ich gekündigt.
"Das Ärztehasserbuch. Ein Insider packt aus" von Werner Bartens ist soeben bei Droemer Knaur erschienen.
Einige Fachbegriffe, damit Sie den Chefarzt und seine Assisten bei der nächsten Visite besser verstehen:
Balneotherapie angeraten: Patient sollte sich dringend waschen oder duschen
Cave linguam: Vorsicht, Patient hört mit!
C2-Abusus: C2H5OH ist die chemische Formel für Alkohol; Patient trinkt zu viel, ist vermutlich Alkoholiker
Extraorbitalinfraluminiert: Patient ist geistig unterbelichtet
Halitosis: Patient hat Mundgeruch
Klimakterisch akzentuierte Vitalitätsschwankung: Nervende Patientin in den Wechseljahren
Logorrhoe, maligne: Patient redet zu viel
Morbus mediterraneus: Klagende, sich beschwerende Haltung von Menschen mit Migrationshintergrund
Pinguis: Patient mit Gewichtsproblemen
In ihrer Alltagsvergessenheit geht vielen Medizinern nicht nur das Gefühl für die Schamgrenze ihrer Patienten verloren, sondern auch für deren Würde
