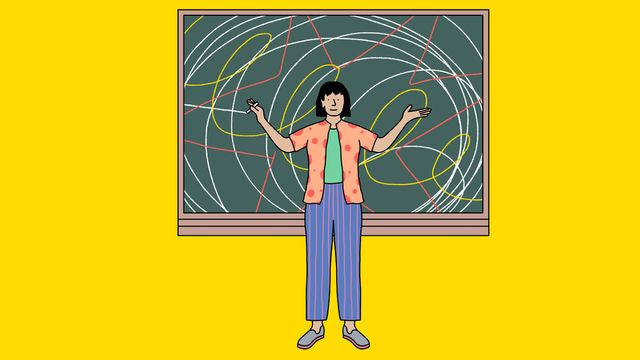An meiner Schule gibt es eine gute Sache: die individuelle Lernbegleitung. Dabei kommen SchülerInnen zu mir, die gefährdet sind, die Klasse in der Mittelstufe wiederholen zu müssen oder aber bereits eine Ehrenrunde gedreht haben. Ich bespreche mit ihnen, woran es liegt, dass sie sich gerade schwertun, und erarbeite einen Plan, wie sie sich besser strukturieren können. Die SchülerInnen sind in der neunten Klasse, alle geflutet von Hormonen, viele lustlos, irgendwie lost in diesem Labyrinth, das sich Pubertät nennt. Schaffe ich es, einen Weg hindurch zu finden, könnte ihnen das Leben etwas leichter machen, denke ich, aber oft bin ich einfach überfordert.
Maximilian saß schüchtern im SMV Büro vor mir. Ich hatte ihn in keiner Klasse, kannte ihn nicht mal vom Sehen. Ich wusste nur, dass er noch in der achten Klasse ein guter Schüler gewesen war, doch mit dem neuen Schuljahr nie etwas Besseres als eine 4- schaffte, selbst in Englisch, wo er vor den Sommerferien noch zwischen eins und zwei stand.
Maximilian wirkte, als würde er bei einem falschen Wort von mir nie wieder mit mir sprechen oder einfach gehen. Diese Option haben nämlich die Jugendlichen, sie müssen nicht erscheinen. Wie also anfangen? Wir sprachen also erstmal über seine Noten, belastbare Haken, an denen ich mich zu ihm vorzuhangeln versuchte. Ich fragte vorsichtig, wie er sich seine Leistungen erklärte. Ich ging von einer Antwort aus, wie sie in solchen Fällen immer kam: »Keine Ahnung!« und auf weitere Nachfrage: »Ich interessiere mich eben nicht dafür« oder »Ich zocke halt gerade gerne«. Mit sowas hatte ich gelernt umzugehen, ich hatte meine Lehrerphrasen, meine Motivationssprüche, warum es sich eben doch lohnt, blabla.
Der Junge sagte minutenlang gar nichts. Sein Blick verlor sich im kargen SMV-Zimmer. Ich wurde unsicher, lobte nochmal seine guten Noten aus dem Vorjahr, als ich aufblickte: Er weinte. Dabei schaute er mir die ganze Zeit in die Augen. In geraden Linien liefen seine Tränen sein Gesicht hinunter. Schließlich sagte er mit gepresster Stimme: »Meine Mama ist gestorben.«
Ich war als Lehrerin noch nie ratlos und voll von Mitleid wie in diesem Moment. Versuchte die Fassung zu wahren, und war gleichzeitig wütend, weil mich niemand informiert hatte, oder schlimmer, dass niemand davon zu wissen schien. Dass dieser Junge mir erzählte, was ihn die ganze Zeit zu Boden zog, dass er mich ausgewählt hatte, obwohl ich ihn in keiner Klasse hatte und noch nie vorher gesehen hatte, ergriff mich. Was wäre gewesen, wenn sich ihm jemand früher zugewandt hätte? Diesem Halbstarken, der ein Dreivierteljahr schon litt und abrutschte, ohne dass davon irgendeiner Notiz genommen hatte.
Weil ich keine Worte hatte, rückte ich näher und nahm seine Hand. Doch alles an ihm schrie: »Fass mich bloß nicht an!« Er verschloss sich wieder. Eine kurze Zeit war die Tür zu seinem Innersten offengestanden, nun fiel sie krachend ins Schloss. Meine Versuche mit ihm zu reden, liefen ins Leere. Alles was ich sagte, kam mir so läppisch vor. Die Idee, ihn an die Schulpsychologin zu vermitteln – natürlich schlug er sie aus. »Bringt nichts!«. Immerhin beschied er meinen Vorschlag, mit seinem Vater zu reden, mit einem zögerlichen Schulterzucken. Wir verabredeten uns für die nächste Woche.
Ich nahm am nächsten Tag Kontakt mit seinem Vater auf. In unserem »Aquarium« – einem kleinen Telefonzimmer mit Glastür zur Pausenhalle – wählte ich während einer Freistunde die Nummer der Familie. Ich räusperte mich, versuchte kläglich professionell zu wirken, als der Vater abhob. Sein Tonfall: distanziert. Ich tastete mich auch bei ihm vor, erzählte von den Noten, dass ich vom Tod seiner Frau erfahren hatte, dass ich glaubte, Maximilian würde sehr unter diesem Verlust leiden und dass ich ihm gern eine psychologische Hilfe vermitteln würde. Der Vater hörte sich alles an, doch meinen Vorschlag mit der Schulpsychologin blockte er ab: »Ich werde einfach weiterhin mit ihm Englisch machen und seine Mathehausaufgaben kontrollieren, das ist der bessere Weg.«
Weitere Gespräche fanden nicht statt. Ich hatte das Gefühl, dass außer mir niemand erkannt hatte (außer vielleicht er selbst), weshalb Maximilian wirklich abgerutscht war. Man muss doch nicht Psychologie studiert haben, um diesen Zusammenhang herstellen zu können. Da war ein Trauma passiert und keine Nachhilfestunde und keine abendliche Kontrolle des Vaters würden daran etwas ändern.
Zu unserer Verabredung eine Woche später erschien Maximilian nicht. Ich ging in der Pause auf ihn zu, fragte nach, er wollte nicht wiederkommen. Ich probierte es noch ein paar Mal, nahm seiner Klassenlehrerin das Versprechen ab, dass auch sie sich seiner annimmt. Die Wochen vergingen, ich hatte neue Sorgenkinder, in der individuellen Lernbegleitung, in meinen eigenen Klassen, Liebeswirren, Ritzen, Scheidung der Eltern. Hin und wieder begegne ich Maximilian im Schulhaus, sehe ihm seinen Schmerz an, frage, wie es ihm so geht. Seine Antworten fallen immer knapp aus.