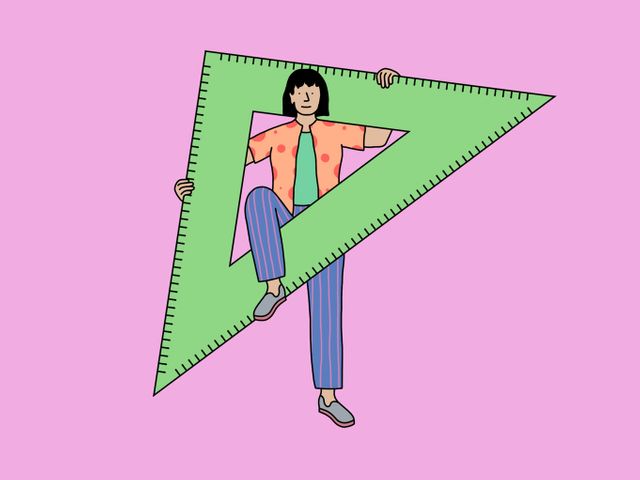Was in meiner Schulzeit und bis in die Nuller Jahre hinein die Epidemie an Essstörungen war, ist heute die massive Häufung von selbstverletzendem Verhalten. Essstörungen unter SchülerInnen gibt es natürlich heute auch noch, aber mein Eindruck ist, dass sie seltener geworden sind. Heute findet sich in so gut wie jeder Mittelstufenklasse ein Mädchen (in selteneren Fällen auch ein Junge), das (bzw. der) sich selbst verletzt.
Ritzen ist Dauerthema im Lehrerzimmer, wobei: Wenn wir Lehrkräfte es merken – und das tun wir oft nicht, weil die SchülerInnnen lange Ärmel tragen –, ist es oft zu spät, um auf die SchülerInnen zuzugehen und irgendwie zu reagieren. Häufig sind die Leistungen dann bereits abgesunken, und oft folgt wenig später der Wechsel auf die Realschule oder in eine Ausbildung.
Jenny ging vor einigen Jahren in meine 10. Klasse. Nie kam sie pünktlich, oft fehlte sie. Sie war ein auffälliges Mädchen mit blauen Haaren, ihren kräftigen Körper versteckte sie in langen, schlabberigen Klamotten. Ihr Äußeres sagte: Auffallen, oder nein, lieber doch nicht. Genau so erlebte ich sie auch im Unterricht: Wir lasen Die Leiden des jungen Werthers von Goethe und im Vergleich auch die Version von Plenzdorf. Während der Rest der Klasse die Leiden als jämmerlich und Werther als Mimose bezeichnete, verteidigte Jenny vehement die beiden Protagonisten. Mir gefiel ihre starke Meinung, die Goethes und Plenzdorfs Romane in ihr ausgelöst hatten. Sie dagegen wirkte nach ihren Wortmeldungen immer etwas beschämt, als wäre sie sich erst dann ihres lauten Organs und ihrer selbstbewussten Erscheinung bewusst geworden, und hätte doch lieber einen Rückzieher gemacht.
An einem schwül-heißen Juni-Tag blickte ich schließlich in einen Abgrund. Schwitzend saßen die SchülerInnen in den Klassenzimmern und versuchten, Schillers Kabale zu durchschauen. Schon in der zweiten Stunde heizte die Sonne den Raum auf, meine Bluse klebte am Rücken fest.
Nach einer Viertelstunde ging Jenny zur Toilette. Wenig später ging die Tür auf, ich erkannte sie kaum wieder. Jenny hatte ihre langen, übergroßen Kleidungsstücke gegen kurze Hosen und ein T-Shirt eingetauscht, offenbar hatte auch sie die Hitze nicht mehr ausgehalten. Die Sonnenstrahlen, die ins Klassenzimmer fielen, beleuchteten ihre Haut wie Scheinwerfer. Ich sah Arme und Beine übersäht mit Narben. Narben, die alt und weiß waren, geometrisch geritzt. Narben, die frisch und rot waren und wulstig hervortraten. Narben, die von so viel Verzweiflung erzählen. Jennys Verzweiflung.
Die anderen blickten kaum auf, als Jenny an ihnen vorbeiging. Offensichtlich wussten sie schon länger Bescheid und der Anblick schockierte sie nicht weiter. Oder waren sie unbeeindruckt und war vielleicht genau das die richtige Reaktion?
Ich legte mir Worte zurecht. Nichts schien zu passen. Jenny setzte sich und arbeitete leise mit ihrer Banknachbarin an den Aufgaben zum Text mit. Ich schaute Jenny an. Sie schaute weg.
Die Zeit verstrich und es gongte. Die Klasse kramte ihre Sachen zusammen und ich ging auf Jenny zu. Hielt sie auf und bat sich zu setzen. Sie versuchte verzweifelt ihre Arme vor mir zu verstecken. »Jenny, wenn ich dir helfen kann…«, – »Frau W. das ist nett, aber Sie können nichts tun…echt.« Sie sammelte schnell alles ein und verschwand aus dem Klassenzimmer.
In derselben Woche redete ich mit der Schulpsychologin, die mir von den schwierigen familiären Verhältnissen von Jenny erzählte. Jenny habe selbst Alkoholprobleme, sei in Behandlung. Sie werde demnächst in einer Pflegefamilie untergebracht. Abgründe, tief, schwarz. Hätte ich Jennys Leid früher erkennen müssen?
Nach weiteren Fehlzeiten, noch vor dem Ende des Schuljahres, verließ Jenny die Schule. Nach den Sommerferien fragte ich bei den Klassenkameraden nach, ob sie etwas von ihr gehört hatten. Keiner wusste etwas Genaues. Pflegefamilie. Ausbildung. Das waren die einzigen Stichwörter, die ich zu hören bekam.
Zwei Jahre später strahlte mich Jennys Klasse von der Bühne an, alle hatten das Abiturzeugnis in der Hand. Es war ein schöner Nachmittag. Unter den Gästen fiel mir ein Mädchen mit weiß blondierten Haaren und einem auffällig glitzernden Spaghettiträgerkleid auf. Ihre Arme waren voller kunstvoller, farbenfroher Tattoos. Das muss ein Meister seines Fachs gestochen haben, dachte ich.
Die junge Frau lächelte mich an. Ich musste zwei Mal hinschauen, bis ich verstand: Es war Jenny! Sie kam auf mich zu. Sie erzählte von ihrer Ausbildung als Biologielaborantin, die sie schon fast abgeschlossen hatte, und dass sie seit einer Weile in Therapie sei. Mit Laura aus ihrer Klasse sei sie weiterhin befreundet. Auch das hatte ich nicht gewusst. Ich sprach sie auf die Tattoos an: »Eine Idee meiner Pflegemutter! Sind die nicht cool?«, sagte sie. – »Ja, wunderschön«, sagte ich.
Mein kläglicher Versuch sie damals anzusprechen, fiel mir wieder ein, er kam mir im Nachhinein noch unbeholfener vor. Was für ein Glück Jenny doch mit ihrer Pflegemutter gehabt haben muss. Jenny verabschiedete sich, ging zu einem Grüppchen ehemaliger Klassenkameradinnen. Ich sah sie kichern.