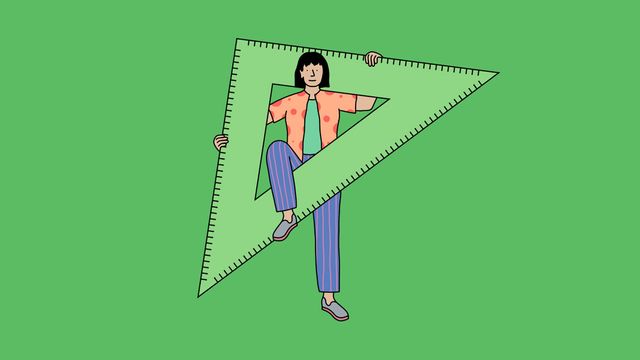So schön unser Theaterbesuch gewesen war, so dumpf fiel ich nach den Ferien wieder auf den Boden der Tatsachen. Sie erinnern sich? Das nette Beisammensitzen nach der Vorstellung, meine liberale Einstellung, mit den SchülerInnen in einer Kneipe noch über das Stück zu diskutieren? Ich wurde verpfiffen, aber nicht von einem Schüler, sondern von einem Vater.
Der Reihe nach. Nach den Ferien war ich trotz unzähliger Korrekturen erholt und noch immer erfüllt von unserem Theaterbesuch, so dass ich mich auf die nächste Stunde in meiner Q11 richtig freute. Im Lehrerzimmer schwärmte ich noch von der Vorstellung und gab ein bisschen mit meinem Kurs an, der sich so prächtig und anständig verhalten hatte, als das Telefon klingelte und ich zum Apparat zitiert wurde.
Herr G., Vater von Julian, eines Schülers aus der Q11, war dran. »Frau W., ihr Engagement in allen Ehren, aber dass sie sich trauen, vor und mit den Schülern Bier zu trinken! Das gehört nicht in Ihr pädagogisches Aufgabenfeld. Halte Sie sich in Zukunft an den Lehrplan und lassen Sie sie die Freizeitspäßchen! Sonst lasse ich meine Kontakte spielen.« Ich war so verdattert, dass ich nur ein »Oh, Entschuldigung« stammeln konnte. Da hörte ich schon das Tuten in der Leitung.
Ich setzte mich mit Bauchweh zurück an meinen Platz und verbrachte die nächsten 30 Minuten meiner Freistunde damit zu grübeln, ob ich wohl zu weit gegangen bin. Dann fiel mir auf, dass Herr G. mir gedroht hatte. Ich verstand die Welt nicht mehr. Sein Sohn ist 17 Jahre alt. Man muss das doch im Kontext sehen: Wir haben nach einem aufregenden Theaterabend das Stück analysiert – ja, in geselliger Runde, aber keiner hat über die Stränge geschlagen, war auch nur ansatzweise betrunken gewesen, alle kamen pünktlich in ihren Heimatort zurück. Natürlich war mir klar, dass man meine Entscheidung – wie alles im Leben – auch fundamental anders beurteilen konnte. Aber ich wusste auch: Drohen und anschwärzen, das ging gar nicht. Ich sah mich schon auf einer Meldeplattform der AfD wieder. »Frau W.« – Name und Schule natürlich ausgeschrieben – »trinkt Bier mit ihren SchülerInnen. Linksgrünversiffte Kuschelpädagogin.«
Auf dem Weg zu meiner Elften geriet ich ins Grübeln. War das nun eine politische Anschwärzung? Oder nur eine ganz normale Eltern-Reaktion, wie es sie immer gab? Was sagt das über mich oder uns Lehrer, dass bei der kleinsten Drohung (»Kontakte spielen lassen«) jetzt sofort die Alamglocken schrillen? Seit wann war ich so ängstlich?
Die AfD hat nicht nur im Bundestag den Ton verändert, sie hat mit ihrer »Meldeplattform« auch das Denunzieren zu einer scheinbar legitimen Praxis gemacht. So legitim, dass ich inzwischen auf Kritik ganz anders reagiere. Sie in eine bestimmte Richtung verstehe. Ich glaube, die Meldeplattformen haben das Zeug, das Klima an unseren Schulen zu vergiften. Seit einigen Monaten herrscht jedenfalls auch zwischen uns KollegInnen große Ratlosikgeit und Sorge. Hat man nicht das Glück, einen Schulleiter zu haben, der loyal hinter seiner Kollegenschaft steht, muss man befürchten, erst an den Pranger gestellt und dann gerüffelt zu werden. Da reicht eine falsche Antwort, ein flapsiger Spruch, eine Karikatur, die man im Sozialkundeunterricht einsetzt.
Finden einzelne KollegInnen wiederum den Mut, wie in Berlin, sich gegen diese Stasi-Methoden zu stellen und in sarkastischen Selbstanzeigen zur Wehr zu setzen, werden sie mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass man als Lehrkörper der Neutralität verpflichtet ist. Ich ließ meinen Blick durch die Pausenhalle schweifen. Sah all diese jungen Menschen und fragte mich, was wir LehrerInnen diesen Kindern und Jugendlichen täglich beibringen wollen. Petzen? Kleinmachen? Ausgrenzen? Als Lehrerin kämpfe ich jeden Tag um ein respektvolles Miteinander – jenseits von Diskriminierung und Rassismus. Und jetzt sollen ich und meine KollegInnen selbst zur Zielscheibe werden?
Wenn in der Vorweihnachtszeit bekannt wird, dass ausgerechnet ein Politiker der AfD Vorsitzender des Bildungsausschusses im bayerischen Landtag wird, verschluckt man sich schon mal am Kaffee im Lehrerzimmer. Ausgerechnet jemand, dessen Partei Schüler gegen ihre Lehrer instrumentalisiert, soll einen wichtigen Posten in der Bildungspolitik bekleiden?
Ja, ich bin zur Neutralität verpflichtet, darf die Meinungsbildung der SchülerInnen nicht vorgeben, aber ich sehe es genauso als meine Pflicht, die Kinder zu mündigen Staatsbürgern zu machen, auch diesen Eid habe ich abgelegt. Ich mache Lena darauf aufmerksam, dass sie ihren Müll in die Tonne werfen soll und zupfe Leon am Ärmel, der Georg versucht, ein Bein zu stellen. Ich will keine »neutrale Schule«. Ich will eine Schule, in der Position bezogen werden darf, in der diskutiert und gestritten werden darf und im Austausch miteinander zu einer Lösung gefunden werden kann. Nicht anonym. Nicht auf Listen. Nicht am Telefon und schon gar nicht unter Androhung.
Auch wenn die deutsche Lehrergewerkschaft das Vorgehen der AfD scharf verurteilt und auch die Bildungsminister der Länder und die Lehrerverbände sich eindeutig gegen diese Art Methoden aussprechen, bleibt es im Grunde doch an uns LehrerInnen den Klassen jeden Tag vor Augen zu führen, welche Werte zu einer Gemeinschaft und einem funktionierenden Miteinander im Sinne der Verfassung und der Menschenrechte dazugehören – und welche nicht. Seit neuestem tun wir das in der absurden Hoffnung, dabei nicht heimlich mit dem Telefon gefilmt zu werden und »nur aus Spaß« in der Öffentlichkeit diffamiert zu werden.
Kurz vor dem Klassenzimmer der Q11 lief ich Julian über den Weg, er sprach mich kleinlaut an. »Hallo Frau W., ich glaube mein Vater hat angerufen. Der hat da was in den falschen Hals bekommen, war sauer auf mich, weil ich noch bei Kumpels abgehangen bin. Tut mir echt leid! Der Theaterbesuch war super!«. Ich lächelte. Vielleicht war es zu früh, die Hoffnung aufzugeben.