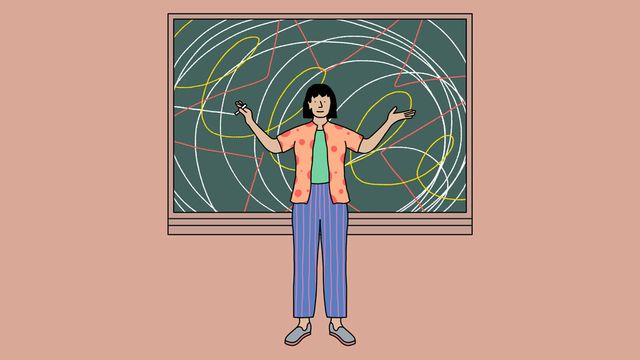Kollegin Miriam war außer sich, als sie im Lehrerzimmer auf mich zukam. »Weißt du, dass du auf Facebook für die Bier-Challenge nominiert bist? Von Mike aus der 10 d?« Vor ein einigen Jahren kursierte in den sozialen Netzwerken die »Aufgabe«, eine Halbe Bier zu exen, davon ein Video zu machen und drei weitere Personen damit herauszufordern. Ich hatte das natürlich nicht mitbekommen und fürchtete sofort, dass mich gleich mein Chef anrufen und fragen würde, ob ich eigentlich noch ganz frisch sei. »LehrerInnen und SchülerInnen brauchen eine gewisse Distanz!«, hörte ich ihn im Geiste. Und gab ihm innerlich sogar Recht. Verdammtes Facebook – ich bereute sofort, meinen Account immer noch nicht stillgelegt zu haben. Was Mike geritten hatte, mich zu nominieren, wusste ich nicht, vielleicht war es in seinen Augen eine Art schräges Kompliment, nach dem Motto: Die Frau W. verträgt schon so ein Späßchen. Ich machte ihn jedenfalls unter vier Augen am selben Tag noch darauf aufmerksam, dass ich die Nominierung daneben fand und dass sie für mich auch dienstliche Konsequenzen haben könnte. Er bekam rote Wangen und versprach, das Video zu löschen.
Mir kam die Anekdote in den Sinn, als ich neulich mit Max, einem unserer Chemielehrer, auf dem Sofa im Lehrerzimmer lümmelte und mal wieder feststellte, dass er und ich doch fundamental andere Ansichten darüber hatten, wie wir unsere Rolle als Lehrer verstehen. Zur Auswahl: »Trennung zwischen Beruf und Freizeit« versus »Ich bin 24/7 und mit jeder Faser meines Körpers Lehrer, es ist einfach eine Berufung«. Also ich gehöre zur ersten Fraktion.
Das weiß ich seit meinem Referendariat, nach dem ich am liebsten an meiner Einsatzschule übernommen werden wollte. Dort hatte einfach alles gestimmt, die Kollegschaft, das Schulprofil und nicht zuletzt der Umstand, dass das Gymnasium vierzig Minuten von meinem Wohnort entfernt war. Ideal! In den harten zwei Jahren der Selbstfindung als Lehrerin war mir nämlich klar geworden, wie wichtig es mir war, einen gewissen Schutzraum im »normalen« Leben zu haben. Einmal war ich während des Referendariats dem Spickzettel-essenden Bengel aus der 10ten, von dem ich vergangene Woche erzählt habe, nachts um zwei in Münchens angesagtester Disco begegnet – es war mir so unangenehm gewesen, dass ich mich panisch hinter meiner Schwester versteckt und fluchtartig die Tanzfläche verlassen hatte.
Ich möchte auch kein erfreutes »Ah, hallo Frau W.« hören, wenn ich mit einer XXL-Packung Tampons an der Kasse warte oder mich in meinem neuen Bikini im Freibad sonne. Auch die Vorstellung, dass ein Schüler mich dabei beobachtet, wie mir mein Mann beim Einparken hilft – oder ich ihm, finde ich unangenehm. Als Lehrer ist man bei Schülern sowieso Dauer-Gesprächsstoff, ich möchte vermeiden, dass sie anfangen, solche Banalitäten aus meinem Leben zu interpretieren. Jugendliche sind distanzlos, und das ist auch ganz oft sehr erfrischend und lustig, nur halt nicht unbedingt, wenn vor versammelter Mannschaft das eigene Privatleben Thema wird (»Wer hat in Ihrer Beziehung eigentlich das Sagen, Frau W.?«).
Abgesehen von München und Nürnberg sind fast alle bayerischen Städte überschaubar, ganz zu schweigen von den Dörfern. Wer als LehrerIn oder DirektorIn dort arbeitet, wo er oder sie auch wohnt, führt fast zwangsläufig ein Leben als lokale Halbprominenz. Und viele meiner KollegInnen scheinen genau das zu mögen. Max, der neben mir gerade in eine Milchschnitte biss, war so einer. Er erzählte kauend, dass er gleich frei hatte. »Ich find’s einfach mega, auf mein Radl zu steigen, den Eltern am Schultor zuzuwinken und in fünf Minuten zu Hause zu sein!« Er blickte durch das Fenster des Lehrerzimmers auf das Pausen-Treiben draußen und hielt einem vorbeigehenden Schüler pantomimisch die Bro-Faust hin. Vielleicht, dachte ich, findet Max es auch einfach mega, in seinem kleinen Königreich der Star zu sein. Ein High Five hier, ein Plausch mit den Eltern auf dem Markt, das war seine Welt. Ich glaube, sein sozialer Status und seine Autorität erwuchsen aus genau dieser Nähe.
Bei mir erwuchsen sie aus der Distanz: Ich bin nicht sonderlich groß, habe naturgemäß keinen dichten Bart und breite Schultern. Um von einer Klasse respektiert und als Autorität angesehen zu werden, bleibt mir nur das, was ich sage und wie ich es sage. Ich möchte selbst entscheiden können, wie nah ich meinen Schülern oder deren Eltern komme. Auf den ersten Blick ist es natürlich sympathischer, den Kumpellehrer zu geben als, wie in meinem Fall, die eher Distanzierte. Nur bin ich der festen Überzeugung, dass, wer alles von sich Preis gibt, auch nichts mehr geben kann: Ich setze Privatheit oft ganz bewusst ein – zum Beispiel, wenn Schüler sich mir im Zwiegespräch anvertrauen, mir von ihren Problemen erzählen. Dann erwidere ich dieses Vertrauen und öffne mich auch. Weil ich ihnen sagen will: »Unser Gespräch ist ein geschützter Raum.«
Auf dem Heimweg sortierte ich meine Gedanken. Als ich schließlich zuhause ankam, setzte ich mich an den Schreibtisch und ging auf Facebook. Ich wollte nochmal überprüfen, ob ich nicht doch mit einem Schüler oder einer Schülerin befreundet war, ohne es gemerkt zu haben. Dann überkam mich die Neugier und ich besuchte Max’ Profil. Weiter unten auf seiner Chronik wurde ich fündig. Er hatte doch tatsächlich auch bei der Bier-Challenge vor fünf Jahren teilgenommen – und viele Likes unserer SchülerInnen bekommen.