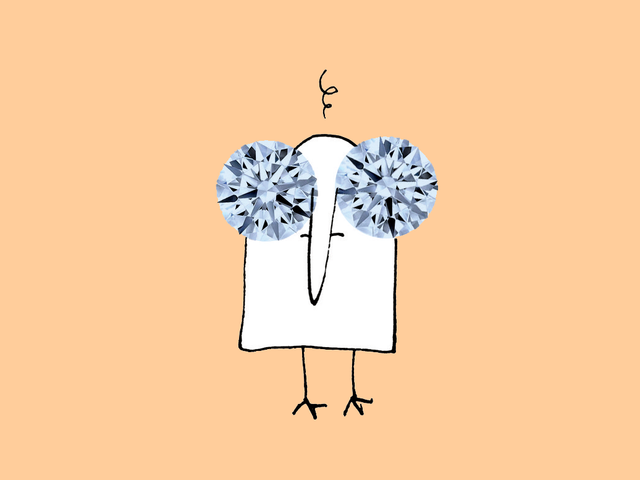Name: Claudio Sieber
Geboren: 1981 in der Schweiz
Wohnort: Philippinen
Website: claudiosieberphotography.com
Instagram: @claudiosieberphotography
Sie haben Goldsucher im kleinen Küstenort Pinut-an auf der philippinischen Insel Leyte besucht. Wenn man sich Ihre Fotos anschaut, hat man den Eindruck, dass die Taucher dort mit recht primitivem Equipment unterwegs sind.
Claudio Sieber: Ja, absolut. Am Strand stehen Kompressoren, an die Schläuche angeschlossen sind. Diese Schläuche nehmen die Taucher in den Mund, durch die bekommen sie unter Wasser Luft. Einige sind so geübt, dass sie mit Hilfe der Schläuche einen ganz Tag unter Wasser arbeiten können.
Wie verhindern die Taucher, dass der Schlauch versehentlich aus dem Mund rutscht?
Dazu braucht man viel Übung. Man beißt mit den Eckzähnen drauf, klemmt den Schlauch also im Kiefer ein. Zum Einatmen löst man den Biss – aber nur ein ganz klein wenig, sonst strömt zu viel Luft in die Lunge. Das muss man ganz vorsichtig regulieren.
Eine Taucherausrüstung mit Sauerstoffflaschen, Taucheranzug und Schwimmflossen kann sich dort wahrscheinlich niemand leisten?
Die Leute leben von der Hand in den Mund, deshalb ist dort alles ein bisschen improvisiert. Nur wenige Taucher haben zum Beispiel eine richtige Taucherbrille. Die meisten haben rustikale Brillen aus Holz, die super unbequem sind. Die Schwimmflossen, mit denen sie gegen die Strömung ankämpfen, machen sie selbst. An ihren Gürteln befestigen sie Steine, um das Gewicht und damit die Tauchtiefe zu regulieren, und den Sand am Meeresboden graben sie mit Kokosnussschalen auf. Bis vor 15 Jahren gab es nicht mal die Kompressoren, die jetzt benutzt werden. Da sind die Leute einfach frei zum Meeresgrund getaucht.
Wird dort schon lange nach Gold gesucht?
Ja, die Spanier haben da schon vor circa 300 Jahren geschürft, allerdings nicht im Meer, sondern oberirdisch. In den 1970er Jahren gab es sogar einen kleinen Goldrausch, ich habe mir sagen lassen, dass zehntausend Filipinos in der Gegend nach Gold gesucht haben. Die einen haben im Stollen gegraben, andere sind den Adern bis ins Meer gefolgt. Heute leben nur noch die Familien der rund 300 emsigen Goldfischer von Pinut-ans Edelmetall, das jetzt vorwiegend unter Wasser liegt. Die meisten arbeiten im Team: Die Taucher holen Sand, Kiesel und Steine herauf. Einige klopfen wohl unter Wasser mit Metallstangen auf die Steine oder reiben loses Geröll nahe dem Ohr aneinander – am Klang können sie erkennen, ob Gold enthalten ist! Oben gibt es Leute, die die Steine zerkleinern und alles dann in Rinnen auswaschen, so dass der Goldstaub gewonnen werden kann.
Man findet also keine glitzernden Nuggets am Meeresgrund?
Nein, die Zeiten sind vorbei.
Lohnt sich die harte Arbeit?
Niemand wird damit reich. Aber sie überleben. Man schürft, damit man Rechnungen zahlen, Essen kaufen und die Kinder in die Schule schicken kann.
Sie sind dort auch selbst getaucht, mit der gleichen Ausrüstung wie die Einheimischen. Wie war’s?
Schrecklich! Ich bin mit einem mit, der ursprünglich auf drei Meter Tiefe gehen wollte, dann aber 15 Meter tief getaucht ist. Ich habe nach oben geschaut und gedacht, das kann ja gar nicht sein. Ich tauche sonst auch, aber mit der üblichen Ausrüstung. Dort ist mir dann der Luftschlauch aus dem Mund gerutscht und ich habe schnell meinen Steingürtel entknotet, weil ich einfach so schnell wie möglich rauf wollte. Aber das war natürlich auch keine gute Idee. Als ich hochkam, habe ich aus der Nase geblutet, leicht hätte Schlimmeres passieren können. Ich bin aber am nächsten Tag nochmal runter, da hat es besser geklappt.
Umso beeindruckender, dass die Goldtaucher das jeden Tag machen und viele Stunden unten bleiben.
Ja, das sind sehr gute Taucher und sehr mutige Menschen. Aber sie wissen ganz genau, wie gefährlich es ist, und ich habe gehört, dass viele diesen Beruf deshalb auch nicht an ihre Kinder weitergeben möchten.
Sie kommen aus der Schweiz, leben aber seit ein paar Jahren auf den Philippinnen. Muss man vor Ort sein, um eine solche Geschichte zu entdecken?
Ich denke schon. Es ist eine dieser Geschichten, die ich nur aufgespürt habe, weil mich einheimische Freunde oder Bekannte darauf aufmerksam gemacht haben. In diesem Fall war es eine Freundin, die Verwandtschaft unter den Goldsuchern hat. Man muss allerdings dazu sagen, dass es auch andere Berichte über Goldtaucher auf den Philippinnen gab und gibt – da geht es aber um Menschen, die in Schächten tauchen, die irgendwo an Land gegraben werden. Leider werden auch Kinder dort hinuntergeschickt, und diese Art des Schürfens ist völlig zu Recht sehr in Verruf geraten. Was ich in der Reportage zeige, also das Schürfen am Strand und im offenen Meer, gibt es meines Wissens sonst nirgendwo.
Sie haben gerade ein Buch namens Gestrandet im Paradies über Ihre Erfahrungen als Reisejournalist in Südostasien veröffentlicht. Daraus erfährt man, dass Sie ursprünglich mal in der Schweiz im Marketing tätig waren. Wie kam es, dass sie diesen Job und ihr bisheriges Leben an den Nagel gehängt haben?
Das Reisen hat mir schon immer imponiert. Aber wenn man nur einmal pro Jahr weg darf, kommt die Rückreise immer viel zu schnell. Besonders stark habe ich das einmal in Japan gespürt, da wusste ich, ich muss häufiger nach Asien, ich brauche einfach mehr Zeit. Ich habe damals als Key Account Manager Dialogmarketingprozesse aufgebaut und da kann man nicht 70 oder 80 Prozent arbeiten – es müssen immer 100 Prozent oder mehr sein. Ich sah mein Leben ziemlich geradlinig ablaufen und habe erkannt, dass ich es gern etwas chaotischer hätte.
Im Buch beschreiben Sie, wie sie monatelang durch Länder wie Kambodscha, Myanmar und Indonesien gereist sind.
Das Oberthema ist, dass wir meiner Meinung nach ein Stück weit verlernt haben, was Reisen eigentlich ist und wie es auch ablaufen kann. Also eben nicht, dass man eine Pauschalreise macht und abends nach einem durchgeplanten Tag mit den anderen am Büffet steht. Auch das gehetzte Abhaken von Sehenswürdigkeiten und Orten, die »instagrammable» sind, lässt nicht wirklich grosse Emotionen aufkommen. Für mich geht es um »Slow Travel« – um das Unterwegssein, ums Lernen, um den Kontakt mit neuen Menschen und um nachhallende Erfahrungen.
Ihre Fotos von den Goldtauchern zeigen nun sicherlich keine Idylle, dennoch habe ich mich beim Anschauen dabei ertappt, wie ich mich selbst an diesen Strand gewünscht habe, wo der Ukrainekrieg und die europäische Energiekrise vermutlich keine Rolle spielen. Oder doch?
Nein, das ist hier alles weit weg. Die Philippinen sind ein Entwicklungsland, in dem die Menschen genug eigene Probleme haben. Auf der Insel Siargao, wo ich wohne, gibt es zum Beispiel nicht mal ein funktionierendes Krankenhaus. Und dass der Strom mal für ein paar Stunden ausfällt, ist total normal. Da braucht nur eine Fledermaus in die Leitung zu fliegen, schon hocken wir im Dunkeln.
Wie gehen die Menschen auf den Philippinen mit solchen Einschränkungen um?
Man lebt hier einfach mehr im Moment. Notgedrungen, denn es gibt kaum Standards und Gewissheiten, auf die man sich verlassen kann. Ich war zum Beispiel heute einkaufen, und es hat mich drei Stunden gekostet, bis ich in mehreren Krämerladen alles zusammengesucht hatte, was ich brauche, und der Kühlschrank wenigstens wieder halb voll war. Das Leben ist hier schwieriger, aber die Lebensfreude ist viel größer, trotz allem.
Andererseits liegt der nächste potenzielle Krisenherd, nämlich Taiwan, ganz in der Nähe. Wie schätzen Sie die Lage dort ein ein?
Für eine Dokumentation über den »Geistermonat« war ich erst kürzlich zwei Monate in Taiwan, ich mag das Land und die Menschen sehr. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis China einmarschiert. Wenn man sich die Agenda der chinesischen Führung anschaut, dann scheint es eigentlich keinen Ausweg mehr zu geben. Geopolitisch sind die Philippinen auf Seiten der USA und stehen der chinesischen Expansionspolitik im Weg, die schon vor Jahren begann. Keiner weiß, wohin das alles führen wird, aber die Aussichten sind beängstigend.