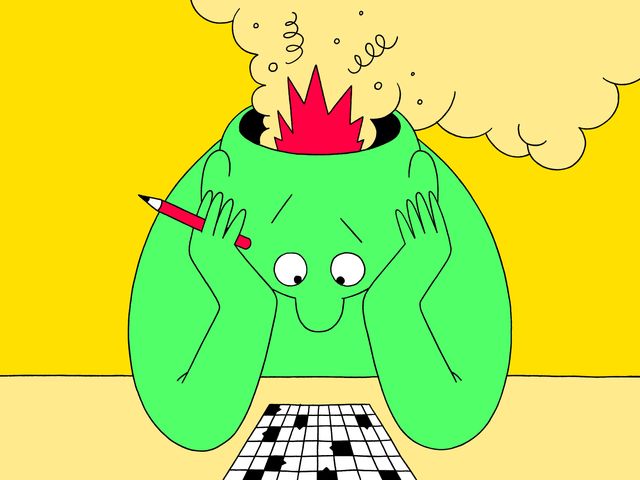SZ-Magazin: Axel Schweiger, Sie arbeiten seit acht Jahren bei der Münchner Tafel. Wie hoch ist Ihre aktuelle Arbeitsbelastung im Vergleich zu normaleren Zeiten?
Axel Schweiger: Einerseits sehr hoch. Denn schon jetzt kommen deutlich mehr Menschen zu uns als vor der Corona-Krise. Menschen, die ihren Job verloren haben oder Kurzarbeitergeld bekommen und sich Lebensmittel in normalen Supermärkten kaum noch leisten können.
Und andererseits?
Erlebe ich so schöne Dinge, dass das die Belastung schon ein Stück weit auffängt.
Erzählen Sie davon.
Als klar wurde, wie gefährlich dieses Virus ist, sind 90 Prozent unserer Helfer*innen vom einen auf den anderen Tag weggebrochen. Denn viele unserer Mitarbeiter*innen sind älter und gehören zur Risikogruppe, sie konnten nicht mehr zur Tafel kommen. Wir befanden uns plötzlich in einer völlig neuen Situation: Weil wir zu wenige waren, konnten wir einige Ausgabestellen nicht mehr besetzen.
Was haben Sie dann getan?
Wir haben Studierende und andere Jüngere, die ihren Beruf gerade nicht ausüben können, gebeten, um 11 Uhr zum Gelände der Großmarkthalle zu kommen, um sie dann auf die verschiedenen Ausgabestellen zu verteilen. Ich ging abends zu Bett und wusste nicht, ob wir am nächsten Tag die Tafeln öffnen können. Am Vormittag standen dann 50 Studierende vor der Tür, um uns zu helfen. Das hat mich unglaublich gerührt. Am nächsten Tag standen 70 Leute vor der Tür, tags drauf 90. Aktuell haben wir über 3000 Helfer. Normalerweise sind wir bei der Tafel München ungefähr 650 freiwillige Mitarbeiter.
Was bewegt die Menschen dazu, bei der Tafel zu helfen?
Außer den Studierenden melden sich auch Gastronomiemitarbeiter oder Freiberufler, die grade unter großen Existenzängsten leiden. Die erzählen uns, dass sie lieber zu uns kommen, um zu helfen, anstatt daheim zu sitzen und Angst vor der Zukunft zu haben.
Brauchen Sie denn tatsächlich so viele Helfer?
Ja. Vor allem am Monatsende sind die Schlangen sehr lang, teilweise müssen die Menschen vier Stunden warten. Normalerweise sind es bis zu zwei Stunden. Die meisten haben dafür Verständnis, aber wenn so viele Menschen ihr Grundbedürfnis befriedigen wollen, kann es schon stressig werden. Auch weil bei den Bedürftigen teils Welten aufeinanderprallen. Leider sind nicht alle Tafelgäste so verantwortungsbewusst, die Abstände einzuhalten. Andere wiederum haben panische Angst vor dem Virus. Da müssen wir manchmal dazwischen gehen, das kostet Nerven und Kraft. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt viele sind.
»Mir selbst hilft es sehr, dass die Menschen wissen, dass sie auf uns zählen können«
Können Sie von einem konkreten Fall berichten?
Eine Frau, die ich schon lange kenne, hat in der Ausgabestelle eine Panikattacke bekommen. Sie hat rumgeschrien, weil sie große Angst hatte, sich zwischen all den Menschen anzustecken. Ich habe sie dann beruhigt und ihr erklärt, dass wir sehr auf die Hygiene achten und Abstände einhalten. Sie kam eine Woche später wieder und hat sich bedankt, dass wir sie nicht rausgeworfen, sondern ihr geholfen haben. Sie hatte an dem Tag ihre Medikamente nicht genommen.
Wegen der Corona-Krise kommen auch Leute, die sonst nicht zur Tafel gehen. Merken Sie einen Unterschied zwischen diesen Menschen und den Bedürftigen, die schon lange zur Tafel gehen?
Für die Gäste, die schon länger zu uns kommen, ist es eine Selbstverständlichkeit geworden, dass sie hier Woche für Woche beschenkt werden. Die neuen Gästen haben oft schon an viele Türen geklopft und keine Hilfe erhalten. Diese Menschen sind oft sehr gestresst und verzweifelt, wenn sie bei uns um Hilfe bitten. Bekommen sie dann hier unbürokratisch eine Notversorgung und können so den Kühlschrank erst einmal wieder füllen, sehe ich vor Dankbarkeit und Erleichterung oft Tränen.
Woran spüren Sie noch, dass Ihr Arbeitsalltag gerade ein anderer ist?
Wir können uns nicht mehr wirklich Zeit mehr für die Menschen nehmen, haben kaum zwischenmenschlichen Kontakt, weil alle Masken tragen und wir die Leute schnell versorgen müssen. Ich sehe wegen der Masken kein Lächeln mehr. Aber es gibt andere Dinge, die mir helfen: Die Empathie unserer jungen Helfer*innen zum Beispiel. Da muss ich manchmal sogar dazwischenspringen und sagen, dass wir leider keine Zeit haben, um lange mit den Menschen zu sprechen. Wir sind die Tafel und wir müssen verteilen, was wir zu verteilen haben. Mir selbst hilft es sehr, dass die Menschen wissen, dass sie auf uns zählen können. Es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden.
Haben Sie wegen dieses Gefühls bei der Tafel angefangen?
Ich habe als Kaufmann früher viel gearbeitet und viel Geld verdient, ich hatte wenig Zeit für Soziales. Dann bin ich in Frührente und wollte eigentlich Bücher schreiben. Mir ist dann aber aufgefallen, dass es ziemlich einsam wird, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Als ich gesehen habe, dass die Tafel jedes Jahr 6,5 Millionen Kilo Lebensmittel vor der Vernichtung rettet und 20.000 Menschen versorgt, hat mich das begeistert. Mittlerweile bin ich sechs Tage die Woche hier und gehe jeden Tag mit der Gewissheit nach Hause, etwas für die Menschen getan zu haben. Das erfüllt mich. Ich bin jetzt 63, und das ist gerade die beste Phase meines Lebens.