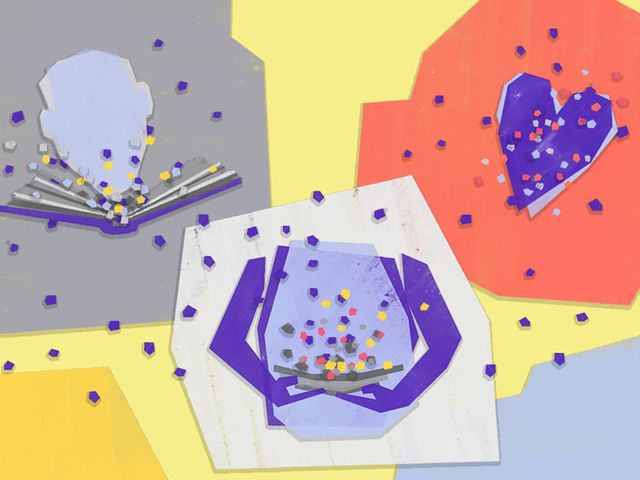»Ich müsste mich mal damit beschäftigen«, heißt es in Gesprächen unter Menschen, die erst einige Jahre lang in die Rentenkasse einzahlen. Diejenigen, die schon weiter sind, sorgen privat vor. Das Bild der Zukunft, das vor den eigenen Augen entsteht, ist eine Zahl auf einem Kontoauszug. Dann sind die Gespräche auch schon wieder vorbei.
Die Gesetzeslage in Deutschland ist so, dass alle, die nach 1964 geboren wurden, mit 67 Jahren die so genannte Regelaltersgrenze erreichen. Für mich, die 20 Jahre später geboren wurde als der jüngste Jahrgang dieser Rentenregelung, wird das wahrscheinlich bedeuten, dass die Jahrgänge um mein Geburtsjahr herum noch einige Jahre länger arbeiten müssen, damit ihnen die volle Rente gezahlt wird. Arbeiten bis 70 oder länger? Für eine Frau meines Geburtsjahrgangs heißt das, dass mir danach vielleicht sogar noch 30 Jahre Lebenszeit bleiben werden, je nachdem, wie zäh ich bin. Zwar liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für Menschen, die in den Achtzigerjahren geboren wurden, grob zwischen 80 und 90 Jahren, meine Großmutter ist jedoch schon 97 geworden. Dass ich eine Frau bin und zur Mittelschicht gehöre, begünstigt, dass ich sehr alt werde. Sowohl ärmere Menschen als auch Männer sterben früher – reichen Greisinnen gehört die Zukunft.
Was machen wir also mit der Zeit, die uns nach dem Renteneintritt bleibt? Das ist die Frage, die mehr fordert als der Gedanke an den Kontoauszug. Uns diese Frage wirklich zu stellen, wie wir die Zeit im Alter nutzen, könnte jedoch auch mehr verändern. Ich finde es aus meiner jetzigen Perspektive jedoch die falsche Frage, auch wenn ich aus Autorinnensicht die Aussicht auf den Ruhestand ziemlich gut finden müsste: Ich bekomme endlich ein Grundeinkommen und kann den ganzen Tag schreiben, ohne den Druck zu haben, damit Geld verdienen zu müssen.
Doch warum stellen wir uns nicht die Frage, wie wir die Zeit, die wir haben, insgesamt anders nutzen? Es macht mich traurig, dass die Phasen des Lebens so stark voneinander abgegrenzt sind. Sich auf den Ruhestand freuen, um endlich Zeit zu haben für die Dinge, für die vorher keine Zeit war? Für Sachen, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel jeden Morgen laufen zu gehen, bin ich dann vielleicht schon zu steif oder zu gebrechlich. Der Ruhestand kann zudem eine neue Art von Stress bedeuten, denn plötzlich sind dort all diese freien Tage, die mit Aktivitäten gefüllt werden müssen, wenn man nicht damit zufrieden ist, jeden Tag ein Buch zu lesen oder darauf zu warten, dass die erwachsene Tochter ans Telefon geht. Wo lernt man eigentlich, eine zufriedene Rentnerin zu sein?
Die beste Altersvorsorge für heterosexuelle Frauen ist, sich mit Freundinnen zu umgeben, mit denen man die letzten Lebensjahre verbringen kann
Realistisch zu bleiben heißt auch, es könnte passieren, dass mein Partner mir wegstirbt, sobald ich endlich mehr Zeit für ihn hätte. Die beste Altersvorsorge für heterosexuelle Frauen ist, sich mit Freundinnen zu umgeben, mit denen man die letzten Lebensjahre verbringen kann. Denn in den typischen Beziehungen, in denen der Mann einige Jahre älter ist, ist es bei den durchschnittlichen Lebenserwartungen, die für Frauen etwa fünf Jahre höher liegen, ziemlich wahrscheinlich, dass sie mindestens die letzten zehn Jahre ohne ihren bisherigen Partner verbringen werden. Ich erwische mich regelmäßig dabei, dass ich vermeintlich ungesundes Verhalten meines Partners argwöhnisch beäuge und mir auf die Zunge beißen muss, um es nicht zu kommentieren. Ich nehme an, er spürt diese Blicke – denn er hat, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, aufgehört zu rauchen.
Das gute Leben auf den Zeitraum des Ruhestandes zu schieben, halte ich für eine schlechte Idee. Wir brauchen diese Zeit schon vorher, damit unsere Partnerschaften und Freundschaften überhaupt bis zur Rente halten und wir die langen Gespräche mit unseren Kindern nicht erst dann führen, wenn wir alle schon graue Haare haben. Die Struktur des Erwerbslebens jedoch verschiebt all diese Dinge, die für ein ausgewogenes Leben wichtig sind, in den letzten Abschnitt unseres Lebens. Sie fragt nicht, ob es die beste Lösung sei, die meiste Zeit für Beziehungen, fürs Weltentdecken, für politisches oder ehrenamtliches Engagement, für Hobbys in diese Phase zu legen. Die Älteren »genießen ihren Ruhestand« ist eine häufige Formulierung für die Zeit nach der Erwerbsarbeit. Aber hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, Sie sollten die Zeit zwischen 30 und 50 genießen?
Man könnte zu dieser Aufteilung des Lebens zum einen fragen: Ist das fair? Je nach Gesundheitszustand, Genetik und Glück bleiben manchen Menschen nach dem Renteneintritt noch 20 schöne Jahre, wer Pech hat, stirbt drei Tage nach der Verabschiedung aus dem Betrieb an einem Herzinfarkt. Das war dann eben ein Leben für die Arbeit. Da kann man nichts machen, nicht?
Wir trennen unsere Gesellschaft nach Altersgruppen und haben zu wenige Räume, in denen sich die Generationen begegnen können
Neben der Frage, ob nach dem Arbeitsleben ausreichend Zeit bleibt, hat die traditionelle Gliederung des Lebens aber einen weiteren Effekt: Wir trennen unsere Gesellschaft nach Altersgruppen und haben zu wenige Räume, in denen sich die Generationen begegnen können. Wie oft spricht ein 30-jähriger Mensch noch mit 80-Jährigen, mit denen er nicht verwandt ist? Wie oft kommen Menschen in der Lebensmitte, die weder professionell noch ehrenamtlich mit Jugendlichen arbeiten oder eigene haben, in Kontakt mit diesen? Was für Generationengespräche werden im Bundestag geführt, in dem das mittlere Alter bei 50 liegt? Sowie in Parteien, in denen die Mitglieder im Mittel sogar noch einmal älter sind? 60 ist das Durchschnittsalter in der Union und der SPD.
Bei der demografischen Entwicklung der deutschen Bevölkerung, in der immer mehr Menschen keine Kinder bekommen und die durchschnittliche Zahl eigener Kinder sich bei 1,5 eingependelt hat, nehmen zudem die innerfamiliären Kontakte zwischen den Generationen ab, weil es vielleicht keine erwachsenen Kinder oder keine Enkelkinder gibt und der Wegzug für den Job aus dem Geburtsort häufige Kontakte untereinander erschwert. Menschen isolieren sich auch innerhalb ihrer eigenen Altersgruppe. Das ist ein Nebenprodukt der demografischen Entwicklung und des zeitlichen Umfangs der Erwerbsarbeit.
Wie könnte man das durchbrechen? Ich bin ab und an entnervt von meinem eigenen Verhalten. Manchmal ruft meine Mutter mehrfach bei mir an, und ich rufe sie erst Tage später zurück. Bei ihrem ersten Anruf war ich in einem Meeting, beim zweiten habe ich meine Tochter auf der Schaukel angeschubst, beim dritten war ich zu müde und hatte keine Lust zu sprechen, oder ich saß nach dem Abendessen noch einmal am Schreibtisch, um Arbeit zu beenden, die ich am Nachmittag nicht geschafft hatte, weil ich auf dem Spielplatz gewesen war. Ein Telefonat mit meiner Familie erscheint mir zuviel oder kommt dann, wenn ich gerade wirklich nicht kann, weil mein Alltag und der meiner Eltern so sehr auseinanderklaffen. Auf der einen Seite ist das ein Verständnisproblem, da ich deutlich mehr in meinen Beruf eingespannt bin, als es meine Mutter zur Zeit ihrer Berufstätigkeit war, und sie sich nur schwer vorstellen kann, wieviel ich arbeite. Auf der anderen Seite befinde ich mich in dem, was man als »Rush-Hour des Lebens« bezeichnet – der Phase im Erwachsenenleben, in der das Leben mit Kleinkindern mit hohen Anforderungen im Beruf wie Einstieg und Aufstieg zusammenfällt. Das ist diese Zeit zwischen etwa 30 und 50, die man überlebt, statt sie zu genießen. An manchen Abenden bin ich froh, wenn mein Partner und ich nach dem Ins-Bett-Bringen des Kindes noch ein paar Sätze miteinander wechseln, die über Smalltalk hinausgehen. »Quality-Time« zu zweit ist dann, noch zusammen eine Serie zu schauen (und vielleicht nicht einmal diese 45 Minuten noch wach bleiben zu können).
In der Realität, in der meine Eltern leben, die beide in Rente sind, ist hingegen ein Überschuss an freier Zeit vorhanden – obwohl sie sich noch um meinen Großvater kümmern, einen Garten haben, das Enkelkind, das in ihrer Nähe lebt, regelmäßig betreuen und in mehreren Ehrenämtern engagiert sind. Ich habe Respekt vor dem Übergang in die Rente, in der Menschen die Fähigkeit brauchen, ihre Woche mit sehr viel weniger äußeren Vorgaben zu füllen, als es das Berufsleben für sie zuvor getan hat. Ich kann diese Phase bislang nur mit meiner Elternzeit vor etwa fünf Jahren vergleichen. Ich hatte zwar ein Baby im Schlepptau und damit genug zu tun, aber ich fiel auch in eine Einsamkeit, weil alle meine Freund*innen arbeiteten, während ich mich nach Gesprächen sehnte und nach Abwechslung. Wenn ich das nun aufs Alter übertrage, wird mir umso deutlicher, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen, aber auch jetzt schon Ideen dafür zu haben, wie ich Freizeit nutzen möchte, was mir Spaß macht.
Das Renteneintrittsalter leitet sich ab aus Berechnungen zur Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, aber nicht aus einer Idee davon, was das »gute Leben« sein könnte
Nur 17 Prozent der Deutschen schaffen es, sich einmal in der Woche mit Freund*innen zu treffen, das besagen die Ergebnisse des Freizeitmonitors 2019. Über alle Altersgruppen hinweg sind fernsehen, Radio hören, telefonieren, das Internet oder das Smartphone nutzen die Freizeitaktivitäten, für die Menschen die meiste Zeit aufwenden. So stehen Menschen im Ruhestand vor der Aufgabe zu lernen, ein Hobby zu haben – vielleicht aber viel wichtiger: Wir sollten genau das über das ganze Leben hinweg nie verlernen. Haben Sie gerade ein Hobby? Etwas, das Sie nur tun, weil es Ihnen Freude bereitet – ohne nützliche, selbstoptimierende Effekte wie Sport, um fit zu bleiben oder an ihrem Körper zu arbeiten? Wenn Sie keine Idee haben und nun nach etwas googeln, ist es gut möglich, dass sie vor allem auf Artikeln landen mit Überschriften wie dieser: »Diese zehn Hobbys machen Sie klüger«. Wenn Sie während ihrer Berufstätigkeit etwas in Ihrer Freizeit unternehmen, dann bitteschön etwas, das auf Ihre Karriere einzahlt.
Was mir in der Beschäftigung mit der Arbeitswelt und den politischen Ideen dazu immer wieder auffällt, ist die eingangs erwähnte Ideenlosigkeit, mit der wir sowohl auf unsere Gegenwart als auch auf die Zukunft blicken. Die Rente verbinden wir mit viel Geld oder weniger. Das Renteneintrittsalter leitet sich ab aus Berechnungen zur Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme, aber nicht aus einer Idee davon, was das »gute Leben« sein könnte. Wo sind die Bilder davon, wie wir insgesamt leben und arbeiten wollen? Fließt in diese politischen Zukunftsbilder ein, was Menschen zufrieden macht und was die Gesellschaft zusammenhält? Oder ist die Rente bloß Mathe?
In den Debatten um die Klimakrise in den vergangenen Monaten wurde immer wieder thematisiert, dass ein neuer Generationenkonflikt bevorstehe, und sowohl von den jüngeren als auch den älteren Gruppen kritisiert, dass intergenerationell zu wenig miteinander gesprochen werde. Ich glaube, dass gerade der fehlende Austausch unter anderem damit zu tun hat, wie die Lebensphasen eines durchschnittlichen Menschen heute entworfen sind. Wir trennen auf diese Art nicht nur die Altersgruppen voneinander, sondern trennen Menschen anhand der unterschiedlichsten demografischen Merkmale so voneinander, dass wir tatsächlich in homogenen Blasen stecken und zu wenig über den Alltag von Menschen wissen, deren Biografie sich von der eigenen stark unterscheidet. Eine politische Zukunftsfrage ist daher für mich, Ideen dafür zu entwickeln, wie Menschen – um mit einem Merkmal als Beispiel anzufangen – über die Altersgruppen hinweg wieder stärker zusammengebracht werden könnten. Brauchen wir dazu in allen Städten und Dörfern Mehrgenerationenhäuser?
Ein Ansatz dafür könnte auch sein, die Menge der Arbeit anders über die Lebensspannen zu verteilen: Wir arbeiten in der Woche weniger, aber dafür auf mehr Lebensjahre verteilt. Menschen arbeiten nicht länger, weil die Rentenkasse ihre Beiträge noch länger braucht, sondern weil sie als Teil einer Gemeinschaft gebraucht werden. Ältere Menschen können nicht nur langjähriges Wissen in eine Organisation einbringen, sondern auch menschliche Kompetenzen, die man über die Zeit erwirbt. Wenn zudem Erwachsene die meiste Zeit an ihren Arbeitsorten sind und hier viel Austausch über berufliche Themen hinaus stattfindet, könnte man das berufliche Zusammensein auch dafür nutzen, den Kontakt zwischen den Generationen zu stärken – selbst wenn das neue Herausforderungen an die Führung von Mitarbeiter*innen stellt und neue Ideen dafür nötig sind, welche Arbeiten ältere Menschen übernehmen können, deren ursprünglicher Beruf sie zum Beispiel körperlich zu stark fordern würde.
Arbeit muss so gestaltet werden, dass Menschen durch sie nicht krank werden
Die Idee, insgesamt länger zu arbeiten, sollte zudem etwas anderes berücksichtigen, wenn sie Akzeptanz erfahren soll: Arbeit muss so gestaltet werden, dass Menschen durch sie nicht krank werden. Zu Recht wird bei der Verlängerung der Lebensarbeitszeit immer wieder eingebracht, viele Jobs seien gesundheitlich so belastend, dass die Mitarbeiter*innen dieser Berufszweige oft schon vor dem Rentenalter zu krank sind, um weiterzuarbeiten. Für diese Berufe ist selbst die 67 utopisch. Warum akzeptieren wir überhaupt noch, dass Arbeit krank machen kann? Wenn Deutschland sich für hohe Standards im Arbeitsschutz loben möchte, ist es widersprüchlich hinzunehmen, dass bestimmte Formen der Arbeit überdurchschnittlich oft Körper oder Psyche so stark belasten, dass sie auf Dauer zu bleibenden Schäden führen. Es ist ein Unterschied, ob man den Ruhestand genießen kann oder ihn mit Schmerztabletten verlebt. Die Antwort auf Überlastung sollte an erster Stelle nicht eine frühere Rente sein, weil nichts mehr geht, sondern eine deutliche Entlastung während der Zeit im Beruf, die gesundheitliche Schäden tatsächlich verhindert. 40 Stunden am Schreibtisch ruinieren den Rücken, 40 Stunden als Pflegekraft ruinieren ihn aber deutlich mehr.
Wir sollten Arbeitsbedingungen, deren gesundheitliche Folgen schon während des Erwerbslebens spürbar sind und erst recht danach, nicht als etwas Unveränderliches – »Das ist nun mal so« – akzeptieren, sondern immer wieder Ideen dafür finden, wie eine Arbeitswelt aussehen kann, in der sich niemand fragen muss, wie man das bloß bis zur Rente schaffen soll. Betroffen von diesem Gedanken sind übrigens nicht nur Menschen, die körperlich schwer arbeiten. In einem DGB-Report von 2019 zur so genannten Arbeitsintensität, die beschreibt, ob die Menge der Aufgaben von einer Person innerhalb ihrer Arbeitszeit zu bewältigen ist, wiesen naturwissenschaftliche und IT-Dienstleistungsberufe mit 35 Prozent die höchste Quote von quantitativ überforderten Mitarbeiter*innen auf. Häufige Anpassungsstrategien an eine zu hohe Arbeitsintensität sind die Reduzierung von Pausen, auch krank zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Die Hälfte der Personen, die sich im Job überfordert fühlten, gab an zu glauben, dass sie ihren Job so nicht bis zur Rente schaffen werde. Die Digitalisierung macht es nicht leichter, bis ins hohe Alter zu arbeiten, wenn ihre ganz eigenen gesundheitlichen Risiken nicht schon jetzt ausgeglichen werden.
Zur Idee, erst mit einem höheren Alter vollständig in den Ruhestand zu gehen, kann es also ganz unterschiedliche Szenarien geben. Wir heben das Alter, ohne etwas Grundlegendes in der Arbeitswelt zu ändern, und nehmen die Effekte, die es sowohl für jede*n persönlich als auch gesellschaftlich hat, einfach hin. Eine positive Vision davon, länger im Beruf zu bleiben, könnte jedoch genauso bedeuten, die Arbeitswelt so zu verändern, dass Menschen gesund und gern noch mit 70 einen Teil ihrer Zeit mit dieser Beschäftigung verbringen. Der Ruhestand wäre weniger Sehnsuchtsort, weil wir das Leben davor schon genießen könnten, und auch die Menschen, die nur 65 Jahre alt würden, hätten bis zu diesem Zeitpunkt genug von ihrem Leben gehabt, genug Zeit für ihre Familie und Freund*innen.