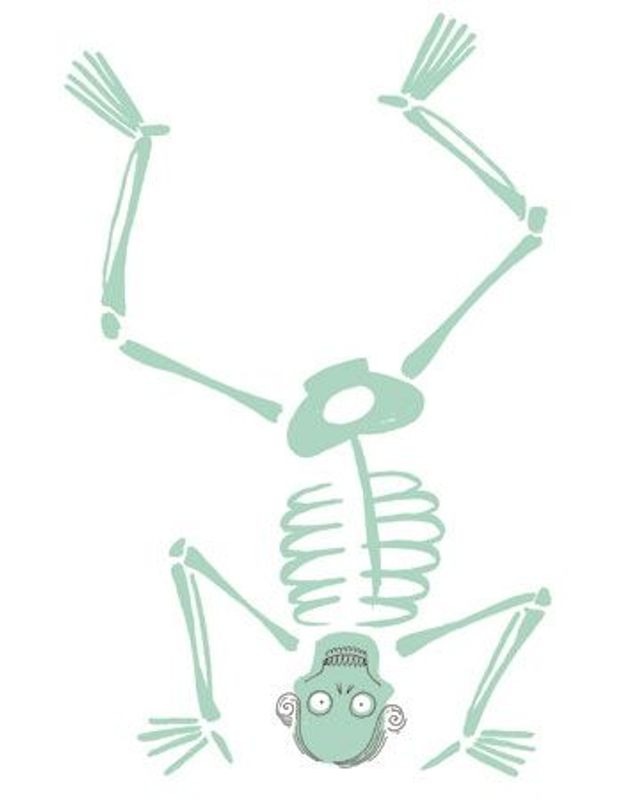In die Debatte, den Niedergang der deutschen Sprache betreffend, hat nun der Riva-Verlag mit einer Presse-Erklärung eingegriffen, in der er »das literarisch genial anmutende Meisterwerk« des Autors Andreas Hock ankündigt: Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann? Über den Niedergang unserer Sprache heißt es und wird seinen Platz finden unter den vielen vom Verlag angebotenen Werken, Nilpferde furzen durch den Mund zum Beispiel, Spiel mit meinen Möpsen oder das I make you sexy Kochbuch mit dem »Bestseller-Abnehmprogramm 10 Weeks BodyChange® by Detlef D! Soost«, wie immer sich diese Titel zum Sprach-Niedergang verhalten.
In der erwähnten Mitteilung wird beklagt, die deutsche Sprache, »die in der Weimarer Klassik an Anmut und Feinheit nicht zu überbieten war«, habe ihre Schönheit verloren. »Goethe und Schiller drehten sich vermutlich im Grabe um, wenn sie hörten, wie Kevin und Chantal sich mit ›Tu mich nicht schubsen‹ oder ›Ich weiß, wo dein Haus wohnt‹ anplärren. Und würden sie dann auch noch Zeuge davon werden, wie Amira-Melinda sich bei Starbucks einen Venti Java Chocolate Chip light Frappuccino to go mit non-fat milk bestellt, würde ihnen sicherlich glatt der Federkiel aus der Hand fallen.«
Dazu ist Verschiedenes zu sagen. Erstens kann es natürlich passieren, dass einem der Federkiel aus der Hand fällt, wenn man sich im Grab umdreht. Dort ist es eng, und man weiß übrigens gar nicht so recht, was es bedeutet, sich im Grab umzudrehen: Legt man sich vom Bauch auf den Rücken, rotiert einmal um die eigene Längsachse oder bettet gar den Schädel, wo vorher die Fußknochen lagen? Zweitens könnte man sich vorstellen, dass Goethe, stets neugierig, statt seinen Federkiel fallen zu lassen, sich Notizen über Frappuccini und fettfreie Milch gemacht hätte, um darüber Austausch mit Eckermann zu pflegen.
Drittens liegen Goethe und Schiller nicht in einem Grab; sie müssten sich, wenn schon, in ihren Gräbern umdrehen.
Aber im Falle Schiller weiß man nicht einmal, wo das ist. Als er im Mai 1805 starb, 27 Jahre vor Goethe, landete sein Leichnam nämlich zunächst in einem Massengrab mit 64 Toten. Später entnahm man von hier nach und nach zwei Schädel und allerhand Knochen, die man mal Schiller zuordnete, mal nicht, ein jahrhundertelanges Hin und Her, das schließlich in sogar zwei Särgen in der Weimarer Fürstengruft und damit der unmittelbaren Nachbarschaft zu Goethes Überresten endete, alles nachzulesen in Rainer Schmitz’ schönem Buch Was geschah mit Schillers Schädel? (Zwischendurch lag einer der fraglichen Schillerschädel bei Goethe daheim auf blauem Samt unter einem Glassturz, Wilhelm von Humboldt sah ihn dort und schrieb: »Der Anblick bewegt einen gar wunderlich.«)
Bloß: Vor ein paar Jahren stellte man mittels einer Untersuchung der Gebeine in der Gruft und ihres anschließenden genetischen Abgleichs mit einigen gleichfalls exhumierten Verwandten fest: Schiller liegt hier nicht. Und Goethe hatte auch, als er sein Gedicht Bei Betrachtung von Schillers Schädel schrieb (»Geheim Gefäß! Orakelsprüche spendend, / Wie bin ich wert, dich in der Hand zu halten?«), wohl gar nicht Schillers Schädel vor sich, sondern Überbleibsel eines anderen, ein Vorgang, der zu Grübeleien über Dichtung und Wahrheit Anlass böte.
Und um es mal so zu sagen: Schiller drehte sich gewiss im Grabe um, erführe er, dass er gar nicht Schiller ist.
Einiges wäre noch zu sagen über Anmut und Feinheit von Pressemitteilungen (»Was noch alles schiefläuft in der deutschen Sprachlandschaft, weiß Andreas Hock«), auch über jene, denen jedes englische Wort im Deutschen ein Feind ist und die für Niedergang halten, was in Wahrheit Leben ist. Sagen wir es mit einem so anmutigen wie feinen Satz aus Goethes Maximen und Reflexionen: »Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt.«
Illustration: Dirk Schmidt