Wer mit Jochen Schledz durch Berlin fährt, wundert sich bald, dass dort immer noch 3,5 Millionen Menschen am Leben sind. An jeder Ecke lauern Gefahren, die Stadt – ein einziges Unfallrisiko. Beispiel Katzbach-/Ecke Kreuzbergstraße: »hier hatten wir schon Radfahrerunfälle«, sagt Schledz. Er biegt in die Yorckstraße ein und deutet auf einen Rohbau: »Da kommt ein Baumarkt hin«, sagt er und schüttelt den Kopf. »Und was, wenn die Kunden von der Gegenfahrbahn links reinbiegen wollen?« Weiter auf die Pallasstraße, wo vor einigen Jahren »unter großem Tamtam« endlich Tempo 30 eingeführt wurde, mit Rücksicht auf einige Schulen und Kitas in der Nähe. Wenig später hat er sein Ziel erreicht: die Kreuzung Bundesallee, Hohenzollerndamm, Na-chodstraße im Stadtteil Wilmersdorf. Ein fußballfeldgroßer Verkehrsknoten, den tagsüber 50 000 Autos und 3500 Fahrräder queren. Die Bilanz: mehr als 1300 Unfälle in zwanzig Jahren.
Kreuzungen sind die Königsdisziplin für Menschen wie Schledz, die sich mit der Sicherheit im Straßenverkehr beschäftigen. Dort ballen sich die Konflikte, weil gleich mehrere »bedingt verträgliche Verkehrsströme« aufeinandertreffen, wie es in der Fachsprache heißt – Autos, Lastwagen, Motorräder, Fahrräder, Fußgänger, Jung und Alt, schnell und langsam. Jeder zweite Unfall in Städten passiert an einer Kreuzung. Schledz steigt aus seinem alten Honda aus, an dieser Stelle muss er etwas ausholen.
Seit acht Jahren leitet er die städtische Unfallkommission. Sein Job besteht darin, die sogenannten Unfallhäufungsstellen in Berlin zu entschärfen. Das sind Straßenabschnitte und Kreuzungen, auf denen es binnen drei Jahren drei Kollisionen mit Schwerverletzten oder fünf mit Leichtverletzten gab. Schledz betont, dass Berlin die sicherste Hauptstadt Europa ist, was den Straßenverkehr angeht. Trotzdem schreibt er fortwährend Berichte und analysiert Gefahrenstellen; er mahnt und warnt, nur um eines muss er sich keine Sorgen machen – dass ihm die Arbeit ausgeht: In Berlin gibt es 500 Unfallhäufungsstellen, vergangenes Jahr verunglückten auf den Straßen der Hauptstadt 17 000 Menschen, 42 davon tödlich. Deutschlandweit waren es 3600 Tote und fast 400 000 Verletzte, was bedeutet: Beinahe jeder Zweite wird im Laufe seines Lebens bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die persönliche Betroffenheit so vieler steht im Widerspruch zum allgemeinen Interesse am Thema Verkehrssicherheit, das meist nach Aushändigung des Führerscheins erlischt.
Es gab Zeiten, da knallten zur besten Sendezeit Autos verkehrspädagogisch wertvoll ineinander. Seit der Absetzung der ARD-Sendung Der 7. Sinn vor acht Jahren beackern nur noch Experten und Bürokraten das Feld, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei hätten sie viel zu erzählen über das schwierige Unterfangen, die Straßen sicherer zu machen, das ständig neue Erkenntnisse hervorbringt und oft genug mit dem irrationalen Verhalten der Verkehrsteilnehmer und kurzsichtigen Kosten-Nutzen-Überlegungen der Verkehrspolitiker kollidiert.
Jochen Schledz steht an der Bundesallee, wenige Meter vor der großen Kreuzung. Mit seinen kurzen grauen Stoppelhaaren und seiner kleinen Brille erinnert er an den Fernsehmoderator Peter Lustig. »Hier haben wir zwei Probleme: Rotlichtverstöße und die Rechtsabbieger zusammen mit den Radfahrern«, doziert er. Die Rotlichtverstöße gehen auf das Konto von Autofahrern, die vom Hohenzollerndamm kommend links abbiegen (siehe Bild rechts). Dazwischen liegen zwei Ampeln, die zweite davon wird regelmäßig übersehen. Folge: 15 Unfälle durch Rotlichtmissachtung in einem Jahr, laut Unfallbericht der Berliner Polizei ein Rekordwert. Zur Abhilfe hat Schledz neue Ampeln mit leuchtstarker LED-Technik und größerem Rotlicht empfohlen. Nicht alle Konflikte lassen sich so leicht lösen.

Gefährliche Linksabbieger Statistisch gesehen stirbt in Deutschland jeden zweiten Tag ein Mensch infolge eines Linksabbiege-Manövers. Eigene Grünphasen für die Abbieger könnten viele Unfälle verhindern. Zudem sanken an Kreuzungen, an denen solche Grünphasen eingeführt wurden, die Kosten durch Unfallschäden um fünfzig Prozent
Radfahrer gehören auf die Straße
Neben der Bundesallee ist ein breiter Fuß- und Radweg, aber für Autofahrer, die rechts in den Hohenzollerndamm biegen, sind die Radfahrer kaum zu sehen. Bäume behindern die Sicht, ebenso ein Abstellplatz für Fahrräder. Am sichersten wäre es, wenn solche Flächen großflächig eingeebnet würden. Das Problem: Die Städte wären dann noch etwas grauer.
Zu ihrem Schutz bekommen Fußgänger und Radfahrer heute an Kreuzungen oft ein, zwei Sekunden Vorsprung. Ihre Ampel springt etwas früher auf Grün und sie befinden sich schon mitten auf der Straße, wenn die Autos losfahren. Davon profitieren aber nicht die Radfahrer, die in voller Fahrt die Kreuzung queren, wenn die Ampel längst grün ist. Statistiken zufolge ist ihr Risiko, von einem Rechtsabbieger übersehen zu werden, viermal so hoch wie das jener Radfahrer, die an der Kreuzung auf Grün warten.
Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Versicherer, sähe die Radfahrer deshalb am liebsten ganz auf der Straße, also immer im Sichtfeld der Autofahrer. Radwege sind ein Relikt der Siebzigerjahre, als die Verkehrsplaner noch von der autogerechten Stadt träumten. »Und sie vermitteln ein falsches Gefühl der Sicherheit«, bemängelt Brockmann. Wer als Radfahrer die Straße benutzt, gerät an Kreuzungen – auch ohne eigene, rot markierte Spur – wesentlich seltener mit Rechtsabbiegern in Konflikt.
Leider nehmen Radfahrer die Situation genau umgekehrt wahr: In jeder Stadt gibt es einige Radwege, die mit einem blauen Schild markiert sind, in der Mitte ein weißes Fahrrad. Es bedeutet: Die Benutzung ist Pflicht. Überall sonst dürften Radfahrer auf die Straße ausweichen. Die wenigsten wissen das, noch weniger machen davon Gebrauch: Eine Studie ergab, dass Radfahrer im Rentenalter sogar zu 99 Prozent auf dem Radweg bleiben – weil sie sich dort sicherer fühlen. Eine andere Studie ergab übrigens, dass sich weibliche Radfahrer auch auf dem Gehweg sehr wohl fühlen.
Der Wert eines Menschenlebens: 1 018 064 Euro und 51 Cent
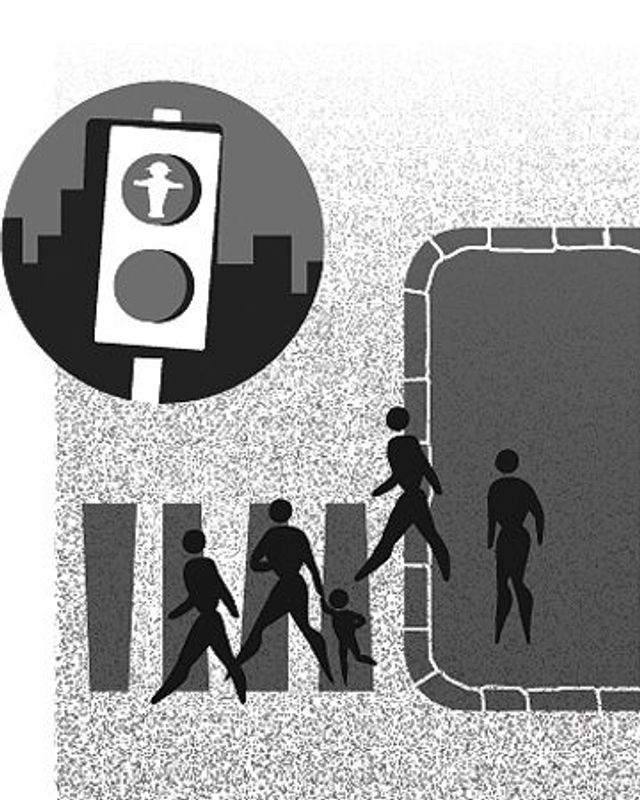
Ungeduldige Fußgänger Ab vierzig Sekunden Wartezeit nimmt die Zahl der Fußgänger, die bei Rot über die Ampel laufen, deutlich zu. Viele Städte haben die Wartezeiten deshalb verkürzt. Vor Schulen und Kindergärten gibt es Druckknopf-Ampeln, die bei Bedarf schnell auf Grün schalten.
Lieber sicher oder schnell?
Zurück zur Bundesallee, Ecke Hohenzollerndamm in Berlin: Für die Rechtsabbieger hat die Berliner Unfallkommission empfohlen, eine eigene Ampelphase einzuführen – eine Lösung, die Sicherheitsexperten häufig empfehlen. Eine zusätzliche Grünphase für die einen bedeutet jedoch längere Wartezeiten für alle anderen, in Stoßzeiten also Stau. Eben das versuchen Straßenplaner zu vermeiden. Sie optimieren Ampelschaltungen so, dass der Verkehr möglichst im Fluss bleibt – ein berechtigtes Anliegen in einer Stadt wie Berlin, die täglich von 1,5 Millionen Autos überrollt wird.
Dabei besagt die Straßenverkehrsordnung: Im Zweifel geht die Sicherheit vor. Wie oft dieser Passus ignoriert wird, zeigt sich besonders am Beispiel der Linksabbieger: Statistisch gesehen stirbt jeden zweiten Tag in Deutschland ein Mensch an den Folgen eines solchen Manövers. Viele Autofahrer überfordert es, gleichzeitig den Gegenverkehr sowie querende Radfahrer und Fußgänger zu beachten. Die Verkehrsforscher sind sich einig, dass es an jeder halbwegs befahrenen Kreuzung mit Ampel eine eigene Grünphase für Linksabbieger geben müsste. Das ist aber vielerorts nicht der Fall.

Im Schongang Ampelphasen sind so ausgelegt, dass Fußgänger auch dann sicher über die Straße kommen, wenn kurz nach Betreten Rot aufleuchtet. Das erfordert eine Geschwindigkeit von 1,2 Meter pro Sekunde. Laut Studien gehen viele Ältere langsamer. Die Phasen sollten ihrem Tempo angepasst werden.
Der Wert eines Menschenlebens: 1 018 064 Euro und 51 Cent
Eine neue Ampelanlage kommt leicht auf 100 000 Euro. Solche Kosten schrecken Städte oft ab. Übersehen wird, dass auch Unfälle im Straßenverkehr die Volkswirtschaft belasten, mit gut 30 Milliarden jährlich. Ein Menschenleben fließt mit 1 018 064 Euro und 51 Cent in die Statistik ein. Der Betrag umfasst Bestattungskosten, Rentenzahlungen an Hinterbliebene und die durchschnittliche Wertschöpfung, die das Unfallopfer als produktives und konsumierendes Mitglied der Gesellschaft noch erbracht hätte.
So zynisch die Kalkulation wirkt, sie belegt, dass Investitionen in die Verkehrssicherheit nicht nur in humanitärer Hinsicht lohnen. Jochen Schledz verweist gern auf die Kreuzung von Kurfürsten- und Schillstraße in der Nähe des Berliner Zoos, wo die Unfallkommission eine Ampelanlage mit eigener Grünphase für Linksabbieger anregte. Schon im Jahr darauf sanken die Kosten, die Unfälle dort verursachten, von 800 000 auf 200 000 Euro. »Da sieht man, was für ein riesiges Sicherheits- und Sparpotenzial da vorhanden ist«, sagt er. Die Rechnung hat einen Haken: Während die Kommune die Lasten trägt, profitieren vor allem die Versicherungen. Sie können die Ersparnis an ihre Kunden weitergeben und die Policen senken – oder Aktionären rund um den Globus die Dividenden erhöhen. Dann profitiert leider nur die Weltwirtschaft.
Eigentlich gäben die Zahlen Anlass zur Freude: Obwohl sich die Fahrzeugdichte in Deutschland seit 1970 verdreifacht hat, sank die Zahl der Toten im Straßenverkehr von 19 200 auf 3600. Damals starben – aus heutiger Sicht unfassbar – 2167 Kinder bei Unfällen. Vergangenes Jahr waren es noch 73. Doch jeder einzelne Fall erschüttert die Öffentlichkeit, selbst in der abgeklärten Hauptstadt Berlin: Als im März 2004 auf der Bismarckstraße ein Lastwagen beim Abbiegen einen neunjährigen Jungen überrollte, wurde eine Bildhauerin beauftragt, an der Stelle ein Mahnmal zu errichten. Jürgen Gerlach, Verkehrsforscher an der Universität Wuppertal, betont denn auch, aus der Statistik lasse sich keineswegs herauslesen, dass unsere Straßen nun sicher geworden seien. »Der Rückgang bei den Getöteten hat viele Ursachen: Rettungsfahrzeuge sind heute nach zehn Minuten am Unfallort – das konnte früher eine halbe Stunde dauern. Die Leute trinken seltener, wenn sie noch Auto fahren. Und die Sicherheit der Fahrzeuge hat sich verbessert.« Mit der Konsequenz, dass es innerorts kaum noch Unfälle gibt, bei denen Pkw-Insassen sterben. »Aber die Verletztenzahlen sind nach wie vor sehr hoch.«
Zu viele Regeln

Berlin-Wilmersdorf, Kreuzung Bundesallee / Hohenzollerndamm / Nachodstraße Täglich mehr als 50 000 Autos, Lastwagen, Busse und Motorräder, mehr als 1300-mal krachte es in den vergangenen zwanzig Jahren an dieser Kreuzung. Zwar gingen die meisten der Unfälle glimpflich aus: wenige Schwerverletzte, keine Toten. Trotzdem stufen die Verkehrssicherheitsexperten den Knoten als sehr gefährlich ein: zum einen wegen der vielen Rotlichtunfälle, die häufig besonders schwerwiegend sind, weil die Unfallgegner oft in voller Fahrt kollidieren. Zum anderen bereiten die Rechtsabbieger Sorgen, die von der Bundesallee zweispurig in den Hohenzollerndamm einbiegen. Die Gefahr, dass dabei Fußgänger und Radfahrer, die den Hohenzollerndamm queren, übersehen werden, ist groß. Radfahrer und Fußgänger sind zwar nur an vier Prozent aller Unfälle in Berlin beteiligt. Aber in einer anderen Statistik fallen sie überproportional ins Gewicht: 75 Prozent der Unfalltoten Berlins im Jahr 2012 waren mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs.
Gefahr vom Supermarkt
Die Forscher scheuen keine Mühen bei der Vermessung des Straßenverkehrs: Sie zählen die Autos an Kreuzungen, werten Unfallszenen und -szenarien aus, verfolgen Radfahrer, um zu ermitteln, wie häufig sie vom Radweg auf die Fahrbahn oder den Gehweg ausscheren. Doch letztlich basieren alle Annahmen und Empfehlungen der Wissenschaft auf Stichproben und Wahrscheinlichkeiten. In der Realität zeigt sich, dass kleine Maßnahmen zuweilen große Wirkung entfalten, etwa eine bessere Straßenmarkierung oder die Beseitigung von Recycling-Containern an einer Kreuzung. Genauso kommt es aber vor, dass Unfallzahlen nach aufwendigen Umbauten steigen statt fallen. Der menschliche Faktor bleibt die große Unbekannte: »Selbst an absolut übersichtlichen Kreuzungen passiert es, dass dort ein Lastwagenfahrer, der gerade seinen Betriebshof verlassen hat und in Gedanken noch bei den Kollegen ist, einen Radfahrer überfährt«, sagt Jochen Schledz. Und woran keiner denkt: Tödliche Unfälle gibt es nicht nur an hoch frequentierten Kreuzungen, sondern auch an der »Einfahrt zur nächsten Tankstelle oder zum Supermarkt«.
Selbst eine so nüchterne Disziplin wie der Straßenbau unterliegt Moden: Vor einiger Zeit fanden es Verkehrsplaner sinnvoll, Rechtsabbieger vor der Kreuzung auf einer eigenen Spur abzuleiten, ohne Ampel. Dann häuften sich Auffahrunfälle nach dem Muster: Fahrer eins schaut nach links, ob die Straße frei ist und bremst, Fahrer zwei im Auto dahinter hat bereits den Überblick und beschleunigt. Ähnliche Konstellationen verursachte der grüne Blechpfeil, der langsam wieder von deutschen Straßen verschwindet. Im Moment werden Kreisverkehre als Lösung aller Probleme gepriesen. Sie schneiden auch gut ab in der Unfallbilanz, weil Autofahrer dort relativ langsam fahren und nicht links abbiegen können. Doch das ändert sich mit der Anzahl der Spuren, in Berlin etwa zählen der dreispurige Große Stern um die Siegessäule und der Ernst-Reuter-Platz zu den unfallträchtigsten Kreuzungen, mit jährlich mehreren Hundert Zusammenstößen.
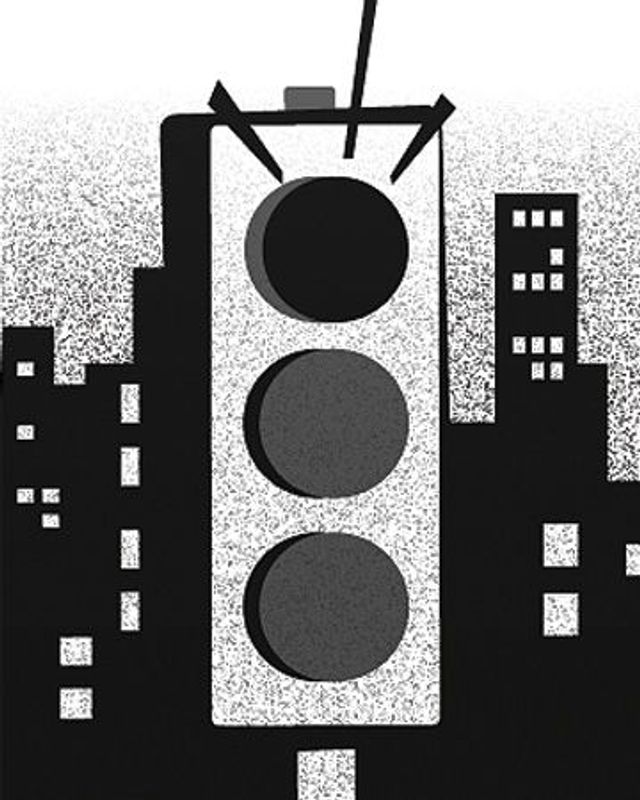
Sinnvolle Nachtschicht Ein Drittel der tödlichen Unfälle im städtischen Straßenverkehr ereignet sich nach Einbruch der Dunkelheit. Ampeln sollten daher auch nachts nicht außer Betrieb sein - was in vielen Städten der Fall ist, um Kosten zu sparen -, sondern auf kurze Grün- und Rot-Phasen geschaltet werden. Das drosselt den Verkehr.
Zu viele Regeln
Es gibt wenig unumstößliche Wahrheiten auf dem Feld der Verkehrssicherheit, aber eines steht fest: je komplexer die Situation, umso unfallträchtiger. Hier setzt die Kritik des Dresdner Verkehrswissenschaftlers Reinhold Maier an: »Jede Stadt schafft ihre eigenen Regeln. Im Grunde müsste man als Autofahrer vor jeder Kreuzung aussteigen und erst mal schauen, was dort erlaubt ist und was nicht.« Die Stadt Münster gab kürzlich einen Leitfaden heraus, was Radfahrer in der Stadt zu beachten haben. Er umfasst fünfzig Seiten. Eine Zumutung, schimpft Maier, gerade für die Älteren. »Viele Menschen bauen im Alter ab. Wir können sie nicht ständig mit neuen Vorschriften überfrachten.« Schon jetzt sind die Hälfte der tödlich verunglückten Fußgänger und Radfahrer älter als sechzig Jahre. Deshalb fordert Maier eine einfache, bundesweit einheitliche Gestaltung der Straßen, zwecks besserer Wiedererkennung. Zudem bauen die Verkehrswissenschaftler auf die Hilfe von VW, Daimler und Co: In den kommenden fünf bis zehn Jahren sollen auf deutschen Autobahnen autonome Fahrzeuge unterwegs sein. Der Wuppertaler Forscher Jürgen Gerlach hofft, dass diese Autos irgendwann auch den schwer kalkulierbaren Stadtverkehr bewältigen und die größte Unfallursache, den Menschen, damit eliminieren. »Künftige Generationen werden sich dann sehr über uns wundern: Die haben es damals in Kauf genommen, schwer verletzt oder getötet zu werden – nur um von A nach B zu kommen!«

Radfahrer - Opfer und Täter Bei 70 Prozent der Radfahrer-Unfälle an Kreuzungen liegt die Schuld beim Unfallgegner (vor allem Pkw, Lkw, Busse). Eine Studie ergab, dass Radfahrer auch viele Konflikte verhindern, indem sie vor Kreuzungen langsamer fahren (60 Prozent) und den abbiegenden Autoverkehr genau beobachten. Andererseits ist etwa jeder fünfte Radfahrer auf Radwegen in der falschen Richtung unterwegs. Das schlägt sich auch in der Unfallstatistik nieder: Kollisionen zwischen links fahrenden Radfahrern und abbiegenden Autos machen ein Drittel aller Unfälle an Kreuzungen aus, an denen der Radweg von der Fahrbahn abgetrennt ist. In Berlin ist die Benutzung der falschen Fahrbahn die Hauptursache für Unfälle mit Radfahrern, vergangenes Jahr gab es deshalb mehr als 1100 Zusammenstöße.
Fotos: Peter Neusser; Illustrationen: Elsa Jenna

