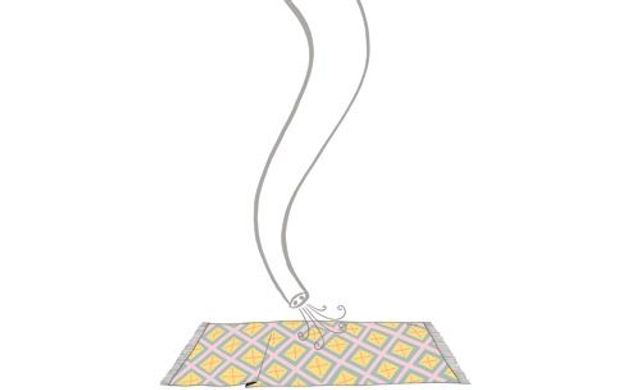Lange Zeit dachte man: Evolution, das ist etwas sehr Langsames; über Jahrtausende passen sich Lebewesen Lebensbedingungen an, die sich ihrerseits auch nur sehr langsam verändern. Die Elefanten zum Beispiel waren ursprünglich riesengroß, absolutes Gardemaß, wie Mammuts. Aber im Laufe der Zeit erkannten sie, dass es bequemer ist, in den Häusern der Menschen zu leben, statt hungrig weitläufige Savannen zu durchstreifen oder als indische Arbeitselefanten sperrige Baumstämme von hier nach dort zu tragen. So schrumpfte der Elefant im Laufe der Zeitalter auf seine heutige geringe Größe, die es ihm ermöglicht, selbst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gehalten zu werden und als Büro-Elefant im Arbeitszimmer geruhsam zu meinen Füßen zu liegen, nachdem er, wie jeden Morgen, den Teppich sorgsam rüsselnd abgesaugt hat.
Allerdings weiß man inzwischen: Evolution, das kann auch rucki, zucki gehen, wenn es sein muss. Neulich las ich von einer Echse namens Rotkehl-Anolis, die bevorzugt auf den niedrigen Ästen von Bäumen in den USA oder der Karibik lebt. Nun gibt es aber Inseln, auf denen sich seit einer Weile der Bahama-Anolis breitmacht, der ebenfalls auf unteren Ästen der Bäume zu leben bevorzugt. Weshalb der Rotkehl-Anolis größere Füße mit klebrigen Sohlen entwickelte, um in höheren Regionen sein Futter jagen zu können, ein Prozess, der nur 15 Jahre dauerte.
So was nennt man Turbo-Evolution. Es ist nichts Neues. In der Londoner U-Bahn lebt eine Mücke namens Culex pipiens molestus, die sich bereits kurz nach der Eröffnung von London Underground 1863 einer unterirdischen Lebensweise angepasst hatte; diese hat ihre Vorteile, wird doch im Minutentakt frisches Blut waggonweise vorbeigekarrt und man muss nicht groß herumfliegen für ein Frühstück.
Auch gibt es in den Rocky Mountains das Dickhornschaf, dessen männliche Exemplare von Jägern erlegt werden dürfen, sobald ihre Hörner eine Drehung von 360 Grad erreicht haben. Was in kurzer Zeit dazu geführt hat, dass es solche Widder nicht mehr gibt. Sie entwickeln derart weit gedrehte Hörner einfach nicht mehr, logisch. Und in Manchester wurde zur Zeit der Industrialisierung von 1848 bis 1898 die helle Variante der Motte Biston betularia von einer dunklen verdrängt, vielleicht weil Ruß die Birkenstämme verdunkelte, auf denen die Motte gern sitzt.
Das sind gute Nachrichten. Denn in Zeiten sich beschleunigenden Klimawandels könnten sie bedeuten, dass sich Tier- und Pflanzenarten auch an rasant sich verändernde Lebensräume anpassen können. »Manchmal können Organismen mit dem menschlichen Einfluss auf die Umwelt Schritt halten«, schreibt der kalifornische Biologe David Reznick in seinem Buch The »Origin« Then and Now.
Was auch für den Menschen hoffen lässt, denn wir haben es ja ebenfalls mit dem sich beschleunigenden Fortschritt zu tun. Viele Tierarten haben sich inzwischen auf diese Veränderungen geradezu spezialisiert, die Mail-Amöbe zum Beispiel, die in unbeantworteter Computerpost lebt und diese von Grünspan freihält. Oder jene Kolibri-Art, die Computertastaturen von allerhand Kleingetier freipickt. Bruno, mein alter Freund, berichtet aus seinem vollautomatischen Büro-Hochhaus, in dem sich Jalousien am helllichten Tage ohne menschlichen Einfluss senken und so das Zimmer verdunkeln, dort gebe es mittlerweile einen Spezialspecht, der in diesem Fall eilends zum Schalter flattere, um den Rollladen zu stoppen und wieder zu heben.
Aber was ist mit dem Menschen, der sich, zum Beispiel, mit zuerst schrumpfenden Handys konfrontiert sah, die sich nun wiederum zügig ins Unförmige vergrößern?
Beruhigende Nachricht: In Kalifornien sind, wie es heißt, die ersten Babys mit Händen so groß wie Baseball-Handschuhe zur Welt gekommen. Sie können schon in der Wiege ein iPhone 6 Plus leicht mit einer Hand halten und bedienen.
Illustration: Dirk Schmidt