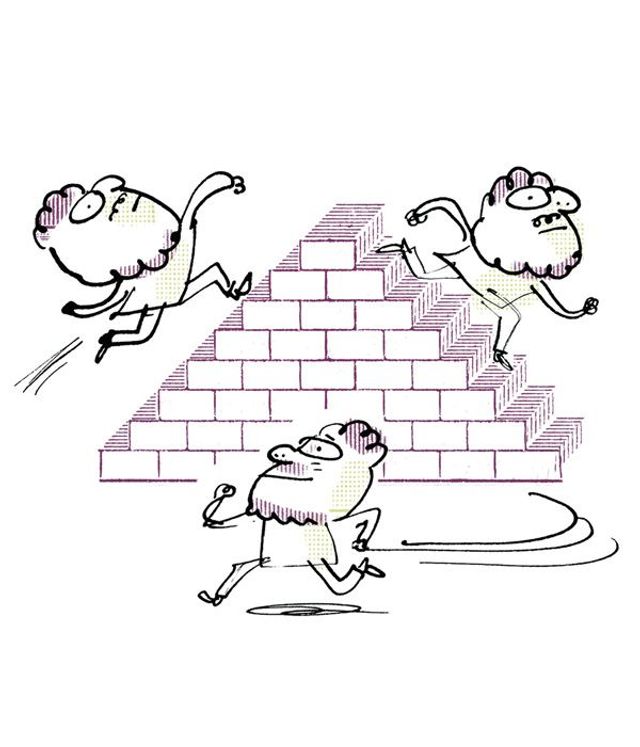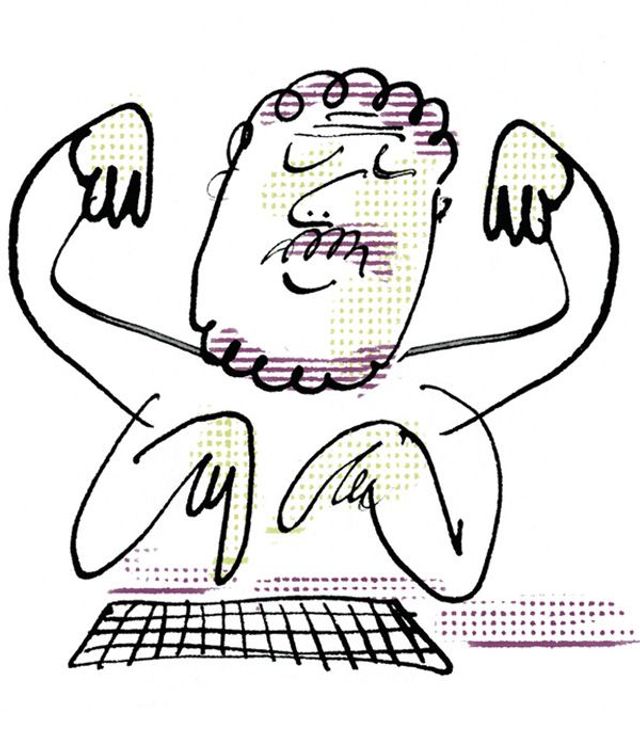TAG 4
10 250 Schritte, 18 Treppenstockwerke, 24,2 % Körperfett, 42 gelesene Buchseiten, 7:38 Stunden im Bett, 21-mal aufgewacht, Nettoschlafzeit 7:07 Stunden – ein ganz normaler Donnerstag.
Seit vier Tagen bin ich Mitglied der Zahlensekte. Offiziell sagt man Self-Tracking dazu. Ziel ist es, durch empirische Selbstvermessung mehr über sich selbst zu erfahren. Die Bewegung ist noch jung: Im Mai 2011 fand die erste weltweite Self-Tracking-Konferenz im kalifornischen Mountain View statt, veranstaltet von Gary Wolf und Kevin Kelly, die den Trend mit ihrer Webseite quantifiedself.com losgetreten haben. Ihr Motto: »Selbsterkenntnis durch Zahlen«. Mitmachen kann jeder. Erstens werden elektronische Sensoren immer besser, kleiner und billiger. Zweitens tragen immer mehr Menschen ein Smartphone mit sich herum, das diese Sensoren auslesen kann oder bereits selbst enthält.
Die Einstiegsdroge für Selbstvermesser heißt »Fitbit One« und kostet rund hundert Euro. Ein schwarzer Sensor, groß wie ein kleiner Finger, den man sich an die Hosentasche klemmen kann. Er zählt, wie viele Schritte ich zurücklege, wie viele Kilometer ich laufe und wie viele Stockwerke ich jeden Tag hochsteige. Je nachdem, ob ich mich viel bewege oder auf dem Sofa herumhänge, wächst eine kleine Blume auf dem Bildschirm – oder sie verkümmert. Spielerische Anreize sollen helfen, das Verhalten zu verändern. Bei mir klappt es sofort: Als ich am Ende des zweiten Tages merke, dass ich mein Soll von 10 000 Schritten noch nicht erfüllt habe, steige ich auf dem Heimweg eine Station früher aus der Tram und gehe den Rest zu Fuß. Albern, aber ein gutes Gefühl. Gesteigert wird es noch, als ich auf der Fitbit-Webseite sehe, dass ich einen Kollegen aus Hamburg um mehr als tausend Schritte geschlagen habe.
Nachts schiebe ich den Fitbit-Tracker in ein Stoffarmband, dort misst er meinen Schlaf. Die Geschwindigkeit und Distanz meiner Joggingrunden berechne ich mit einem Sensor, der in meinem Laufschuh steckt. Meinen genauen Aufenthaltsort lasse ich von Google Latitude mithilfe meines Smartphones ermitteln. Die Handy-App »ReadMore« hält fest, wie viele Buchseiten ich jeden Abend vor dem Einschlafen lese; und britische Forscher, die eine App namens »Mappiness« entwickelt haben, piepen mich zweimal am Tag an und fragen meine Lebenszufriedenheit ab. Was mir noch fehlt: ein Sensor, der misst, wie viel Zeit ich jeden Tag mit der Datenerhebung verbringe. Daumenpeilung: eine knappe Stunde täglich.
TAG 8
13 148 Schritte, 35 Stockwerke, 6:16 Stunden am Computer, 60 % Produktivität, 11 Buchseiten, 10,1 Kilometer gejoggt – Tageswerte vom Montag.
Die meisten meiner Freunde finden mein Experiment bescheuert. Dabei messen sie sich doch auch dauernd: Sie stellen sich auf die Waage, drucken ihre Kontoauszüge aus. Ich zähle ab sofort jeden Euro, den ich ausgebe, mit einer App namens »Budget«. Während bei den meisten nur Mark Zuckerberg und Google wissen, was sie kaufen und auf welchen Seiten sie im Internet surfen, erobere ich mir die Herrschaft über mein Leben zurück: Mithilfe des Programms »RescueTime« analysiert mein Computer genau, wie viel Zeit ich bei Facebook oder Ebay verbringe und wie viel Zeit mit dem Schreiben von Mails oder Word-Dokumenten.
Natürlich werde ich ständig gefragt, was dieser Datenwahnsinn soll. Ich kontere jedes Mal mit Studien: So nehmen Menschen, die sich täglich wiegen, leichter ab als die, die sich nur auf ihr Gefühl verlassen. Und Menschen mit Schrittzähler bewegen sich tatsächlich mehr. In der Politik und der Wirtschaft ist es selbstverständlich, sich an Zahlen zu orientieren. Im Privatleben wirkt es immer noch spießig. Ein Tagebuch zu führen gilt als sensibel, eine Excel-Tabelle über das eigene Privatleben riecht dagegen eher nach Zwangsstörung.
Die Jagd nach Zahlen verändert tatsächlich mein Leben. Der kleine Sensor hat innerhalb einer Woche das geschafft, was mir vorher mehr als 30 Jahre lang nicht gelungen ist: Ich benutze die Treppe, auch wenn ein Aufzug da ist. Eine zweite Einsicht der Selbstquantifizierung: Die eigenen Einschätzungen kollidieren ziemlich hart mit der Realität. Wir verschätzen uns nämlich andauernd. Manche dieser Verzerrungen haben mit unserem mangelhaften Gedächtnis zu tun, andere mit sozialer Erwünschtheit: Wie viel Geld gebe ich pro Tag aus? Wie oft mache ich Sport? Wie viele Stunden arbeite ich am Computer, ohne mich von Katzenvideos ablenken zu lassen? Wie viel Alkohol trinke ich? Beeinflusst irgendwas davon meinen Schlaf, meine Zufriedenheit, mein Gewicht?
Ich dokumentiere meinen Alkoholkonsum und meine komplette Ernährung, indem ich alles, was ich esse oder trinke, auf einer Webseite eintrage, die mir dafür Kalorien, Eiweißgehalt, Zucker und Dutzende andere Werte ausspuckt. Eine App namens »MealSnap« hilft mir dabei: Ich muss meine Mahlzeit nur fotografieren und hochladen, nach wenigen Sekunden erhalte ich eine Kalorienschätzung. Manchmal geht es kolossal schief, aber meistens funktioniert es überraschend präzise: Im selbst gemischten Müsli erkennt der Computer (oder ist es ein indischer Billiglöhner?) sogar die Apfelschnitze und Bananenscheiben.
Jede E-Mail, jedes Telefonat, sogar jeder einzelne Tastaturanschlag wird registriert.

TAG 16
7448 Schritte, 9 Stockwerke, Zeit am Computer 4:57 Stunden, Zufriedenheitsfaktor 0,81, Zeit im Bett 7:06 Stunden, Tiefschlaf 0:53 Stunden – meine Zahlen vom Dienstag.
Für die Nachtmessungen rüste ich nach einer Weile auf: Der Fitbit-Sensor kann zwar erkennen, wie lange ich brauche, um einzuschlafen, und wie oft ich aufwache, aber wie tief ich geschlafen habe, weiß er nicht. Ein zweiter Sensor der Firma Zeo verspricht Abhilfe. Als ich das erste Mal mit dem Stirnband das Schlafzimmer betrete, bekommt meine Frau einen Lachanfall: »Bring mir einen Goldklumpen mit, wenn du runter in die Mine fährst«, sagt sie. Dafür liefert die erste Nacht ein klares Ergebnis: Ich schlafe grauenvoll. Ich bin ziemlich sicher, es liegt daran, dass der Gurt um meinen Kopf zu eng sitzt.
Wenn mich meine Frau die letzten Jahre gefragt hat, wie ich geschlafen habe, waren meine Antworten: »Och … ganz gut« oder »Och … geht so«. Jetzt bombardiere ich sie mit Details: Aufwachhäufigkeit, Nettoschlafzeit, Tiefschlaf- und REM-Phasen – noch vor zwei Jahren hätte man für diese Werte das Schlaflabor einer Uniklinik gebraucht. Das Ding verrät mir sogar meinen Schlafquotienten: 100 ist das Maximum; liegt er über 80, bin ich zufrieden. Esse ich spät und viel, schlafe ich schlechter. Schlafe ich genug und tief, fühle ich mich am nächsten Tag besser. Logisch? Klar, aber jetzt habe ich den Beweis. Und komisch, auf einmal gehe ich wirklich früher ins Bett. Spießig? Sicher. Aber für eine dritte Folge Downton Abbey um Mitternacht hätte es auch keinen Exzesspokal für ein besonders aufregendes Leben gegeben.
Natürlich kann man das lächerlich finden, aber es gibt auch interessantere Fälle als mich: So stellte ein Mann aus Boston mithilfe monatelanger Messreihen fest, dass er besser schläft, wenn er vor dem Zubettgehen eine Brille mit Gläsern trägt, die blaues Licht herausfiltern. Eine Frau, die jahrelang an Migräne litt, konnte durch Self-Tracking Milchprodukte und Gluten als Auslöser für ihre Kopfschmerzen identifizieren. Matt Bianchi, Neurologe und Schlafforscher am Massachusetts General Hospital sagt: »Ich bin sehr skeptisch geworden, was klinische Studien zur Schlafforschung betrifft, und deshalb sehr neugierig, was die Daten von Einzelpersonen zeigen.«
TAG 27
19 071 Schritte, 14 Stockwerke, 23,3 % Körperfett, 16 Buchseiten, 8:52 Stunden im Bett, 19-mal aufgewacht, Nettoschlafzeit 8:03 Stunden, 16,6 Kilometer gejoggt – Wochenendwerte vom Samstag.
Der Suchmaschinenprogrammierer Stephen Wolfram quantifiziert sein Leben schon seit über zehn Jahren. Jede E-Mail, jedes Telefonat, ja sogar jeder einzelne Tastaturanschlag (über 100 Millionen bislang, rund sieben Millionen Mal davon die Löschtaste) wird registriert. Zusätzlich zählt Wolfram jeden seiner Schritte und misst, wie viele Meetings er wann hat und wie lange diese dauern. »Vielleicht verrät mir all das etwas über mich selbst«, schreibt er in seinem Blog, »auch wenn ich zugeben muss, dass ich nicht genau weiß, was.«
Die Frage nach der Erkenntnis wird auch auf dem Show & Tell-Treffen der Berliner Quantified-Self-Anhänger heftig diskutiert. Das Treffen findet in einem Hackerclub in Kreuzberg statt; die rund 50 Gäste sind fast ausschließlich männlich, eine Mischung aus schwarzen Kapuzenpullis, Funktionsjacken und Button-down-Hemden. Es ist genau diese Schnittmenge aus datengläubigen Nerds und konsumgläubigen Jungmanagern, die Quantified Self zum großen Ding der nächsten Jahre machen könnte. 90 Millionen tragbare Sensoren sollen bis 2017 verkauft werden, schätzen Marktforscher. Wird das dauerhafte Datensammeln irgendwann so selbstverständlich wie der Blick auf die Waage? Apple hat schon die Patente für Kopfhörerstöpsel angemeldet, die automatisch Puls, Sauerstoffgehalt im Blut und Körpertemperatur messen, während man mit seinem iPhone telefoniert oder Musik hört.
Einer der Vortragenden benutzt gerade fünf verschiedene Tracking-Armbänder gleichzeitig, um die Ergebnisse miteinander zu vergleichen. Ein anderer erklärt, wie man seine Gesundheitswerte anonym in große Datenbanken einspeist und dort mit den Luftdruck- und Pollenwerten korreliert, die öffentliche Umweltmessstationen automatisch zuliefern. Meine eigenen Ergebnisse nach einem Monat sind vergleichsweise bescheiden: Dadurch, dass ich erfasst habe, wie viel Geld ich für Einzelfahrscheine ausgebe, habe ich gelernt, dass sich eine Monatskarte lohnt – obwohl ich vorher das Gegenteil geschworen hätte. Ich achte mehr auf regelmäßigen Schlaf, bessere Ernährung und genügend Bewegung. Letzteres sogar, wenn niemand mitzählt: Als meinem Sensor, den man etwa einmal pro Woche aufladen muss, der Strom ausging, habe ich trotzdem die Treppen genommen, obwohl es in keiner Statistik auftauchen würde. Ein kleiner Schritt für die Menschheit – 54 große Schritte für mich.
Illustrationen: Serge Bloch