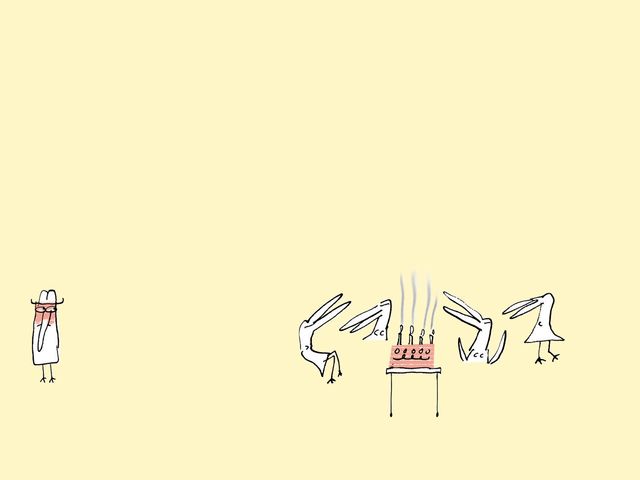Mark Zuckerberg erkannte im Jahr 2007, dass er dringend Hilfe brauchte: Facebook, das von ihm gegründete soziale Netzwerk, wuchs so schnell, dass er sich mit seinen 23 Jahren überfordert fühlte. Bei einer Weihnachtsparty im Silicon Valley lernte er eine Frau kennen, die ihm bereits empfohlen worden war: Sheryl Sandberg, 15 Jahre älter als er und Topmanagerin bei Google im Rang einer Vizepräsidentin. Zuckerberg hatte sie nie angerufen, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass jemand in ihrer Position die Brocken für ein Unternehmen hinschmeißen könnte, das kaum etwas erwirtschaftete. Doch Sandberg war einem Wechsel nicht abgeneigt, da Google ihrem Wunsch, in der Hierarchie aufzusteigen, nicht entsprochen hatte.
Drei Monate später bot Zuckerberg ihr an, bei Facebook Geschäftsführerin zu werden. Seine Überlegung: »Es gibt Menschen, die gute Manager sind und mit großen Organisationen klarkommen. Und es gibt Menschen, die eher analytisch strukturiert sind und Strategien entwickeln. Beides zusammen findet man selten in ein und derselben Person, und ich selbst sehe mich eher im zweiten Lager.«
Als Sandberg im März 2008 bei Facebook anfing, waren manche Insider skeptisch. Als ehemalige Managerin eines Großkonzerns passte sie möglicherweise nicht zu einem Newcomer, außerdem war es für eine Frau gewiss nicht leicht, in einem Unternehmen Erfolg zu haben, das – wie die gesamte Kultur des Silicon Valley – von Männern dominiert wurde. Sie selbst zerbrach sich über etwas ganz anderes den Kopf: »Die Frage, die am dringendsten beantwortet werden musste, lautete: Wie können wir jemals Gewinn machen?«
Wie bei Google ein Jahrzehnt zuvor waren auch bei Facebook die Entwickler vor allem daran interessiert, eine coole Website ins Netz zu stellen, die Gewinne würden sich schon einstellen. Am logischsten erschien es, auf Werbeeinnahmen zu setzen, doch das kollidierte mit dem Umstand, dass die Mitglieder von Facebook ihre Seiten für etwas Privates hielten und nicht durch Werbung belästigt werden wollten, während sie mit ihren Freunden kommunizierten. Manche sagten Facebook deswegen schon das Schicksal von Myspace voraus, jenes mittlerweile fast schon wieder vergessenen Netzwerks, das wie ein Komet geleuchtet hatte, ehe es rasend schnell wieder verglühte. Nach exzessiven internen Debatten entwickelte Sandberg ein Geschäftsmodell, das zwar auf Anzeigen setzte, diese aber so unaufdringlich wie möglich platzierte. 2010 war das Unternehmen, das bei Sandbergs Eintritt 2007 noch viel Geld verbrannt hatte, profitabel geworden. Innerhalb von drei Jahren hatte sich Facebook von 130 auf 2500 Mitarbeiter vergrößert, die Zahl seiner Mitglieder auf 700 Millionen verzehnfacht.
Sandberg, 1969 als Tochter einer Französischlehrerin, die ihren Beruf für ihre drei Kinder aufgegeben hatte, und eines Augenarztes geboren, hatte in Harvard Wirtschaftswissenschaften studiert und den Kurs für Wirtschaft im Öffentlichen Sektor beim späteren US-Finanzminister Lawrence Summers belegt. Summers war von ihren Leistungen so beeindruckt, dass er zu ihrem Mentor wurde, sie als Assistentin zur Weltbank holte und schließlich zu seiner Stabschefin in Washington machte. Nachdem die Demokraten 2000 die Wahlen verloren hatten, zog Sandberg ins Silicon Valley, an jenen Ort, an dem die digitale Revolution am aufregendsten war, und gab Ende 2001 dem Buhlen von Google nach. Das Unternehmen war damals gerade drei Jahre alt und hatte noch lange keinen überzeugenden Businessplan, dafür die kühne Vision, »das Wissen der Welt allen Menschen zugänglich zu machen«. Schnell wurde Sandberg im Unternehmen unentbehrlich. Sie machte Googles Anzeigengeschäft profitabel und überwachte einen Millionendeal mit AOL, als das damals noch mächtige Internetportal Google zu seiner Suchmaschine machte.
2005 hatte Sandberg, wie sie es nennt, einen »Aha-Moment«. Das Wirtschaftsmagazin Fortune hatte sie zu seinem alljährlichen »Most Powerful Women Summit« eingeladen. Sie nahm an, beklagte sich aber bei der Organisatorin über den etwas hochtrabenden Namen der Veranstaltung. Die konterte mit der Frage, was denn so falsch daran sei, wenn Frauen Einfluss hätten.
Im selben Jahr bekam Sandberg, die sich irgendwann in ihren besten Freund Dave Goldberg verliebt und ihn geheiratet hatte, ihr erstes Kind, inzwischen sind es zwei. Mit der eigenen Work-Life-Balance beschäftigt, begann ihr aufzufallen, wie viele Frauen bei Google und in anderen Unternehmen aus dem Arbeitsleben ausschieden, sobald sie Mutter wurden – auch weil ihr Kinderwunsch sie davon abgehalten hatte, sich für Positionen ins Zeug zu legen, die ihnen wirklich etwas bedeuteten. Während ihrer sechs Jahre bei Google hatte sie unzählige Männer und Frauen eingestellt. Die Männer, erzählt sie, »kamen voran, sie kratzten ständig an den Türen, um neue Herausforderungen, Beförderungen, die nächste große Aufgabe zu bekommen. Die Frauen waren ganz anders. Man musste sie zu neuen Aufgaben schubsen, fragen, ob das nichts für sie wäre.«
Bei all den progressiven neuen Unternehmen – Facebook, Twitter, Zynga, Groupon, Foursquare – sitzt keine einzige Frau im Verwaltungsrat. PayPal kommt auf eine Frau im fünfköpfigen Spitzengremium, bei Amazon ist es eine von acht, bei Google sind es zwei von neun. Auf die Frage, warum bei Facebook nur Männer im Verwaltungsrat sitzen, sagt Mark Zuckerberg: »Ich interessiere mich für Leute, die Facebook weiterhelfen können, und es kümmert mich nicht besonders, welches Geschlecht sie haben. Ich hake bei Personalentscheidungen ja keine Checklisten ab.«
Dass es im Silicon Valley so wenige weibliche Spitzenmanager gibt, liegt auch daran, dass nur wenige Frauen Programmiererinnen werden. Schon Mädchen sind davon überzeugt, Software, Videospiele und Programmieren seien Jungs-Domänen, und Marissa Mayer, Vizepräsidentin bei Google, sagt: »Sie fühlen sich vom Stereotyp des blassen Hackers abgestoßen, der die ganze Nacht über Codes brütet.«
Im Dezember 2010 hielt Sandberg bei der einflussreichen TEDWomen Conference einen Vortrag über den Umstand, dass es zu wenige Frauen in Spitzenpositionen gibt. Die von ihr genannten Zahlen sind entmutigend: Obwohl inzwischen Frauen mehr Universitätsabschlüsse und Doktortitel erwerben als Männer, schaffen sie es noch immer nicht nach ganz oben. Von weltweit 190 Regierungschefs sind bloß neun Frauen, unter den Parlamentariern der Welt haben die Frauen einen Anteil von nur 13 Prozent, und im Geschäftsleben nehmen Frauen lediglich etwa 15 Prozent der Spitzenpositionen ein.
»Wenn sie wollte, könnte sie jedes Unternehmen leiten«, sagt Mark Zuckerberg
In ihrem Vortrag schlug Sandberg dreierlei vor. Erstens: Frauen müssen ihr Vorankommen selbst aktiv in die Hand nehmen. Ihr zufolge verhandeln 57 Prozent der Männer, doch nur sieben Prozent der Frauen, die einen neuen Job antreten, ihr Gehalt selbst. Zweitens: Frauen müssen darauf achten, dass ihr Lebenspartner tatsächlich ein Partner ist. Solange sie zwei Drittel der Hausarbeit verrichten und drei Viertel der Kinderbetreuung übernehmen, sind sie nicht wirklich gleichberechtigt. Und drittens: »Mach dich nicht aus dem Staub, ehe du wirklich gehst. Sobald eine Frau beginnt, über Kinder nachzudenken, hebt sie ihre Hand nicht mehr, sondern fängt an, sich zurückzulehnen.«
In den Monaten danach ist Sandbergs TED-Rede im Internet von mehr als 650 000 Usern abgerufen worden. Doch es gab auch Kritik an ihren Macht-doch-mal-Appellen. Sandberg sei alles andere als die typische berufstätige Mutter, sie habe zu Hause ein Kindermädchen und im Büro einen Stab, sie sei viel zu privilegiert, um über die Schwierigkeiten normaler Frauen in der Arbeitswelt Bescheid zu wissen.
Sylvia Ann Hewlett, Leiterin des »Gender and Policy«-Programms an der Columbia University, meint, Sandberg unterschätze die Hindernisse, mit denen Frauen es im Beruf zu tun bekommen. Ihr zufolge existiert immer noch eine allerletzte »gläserne Decke« auf dem Weg nach ganz oben, die weniger von Sexismus verursacht wird als von einem Mangel an Unterstützung. Während Spitzenmanager männliche Nachwuchstalente nach Kräften fördern, sind Frauen zu häufig auf sich selbst und Zufälle angewiesen. Sandberg könne das nicht sehen, weil es ihr selbst anders ergangen sei. »Sie hatte Larry Summers und andere, die für sie in den Ring stiegen. Das ist bei einer Frau höchst außergewöhnlich.«
Hewletts Forschungen ergeben, dass zwei Drittel der männlichen Führungskräfte davor zurückschrecken, Frauen unter ihre Fittiche zu nehmen, und Frauen zur Hälfte Unterstützung auch nicht in Anspruch nehmen wollen. Grund dafür: »Mentorenverhältnisse zwischen einem älteren, verheirateten Mann und einer jungen, alleinstehenden Frau finden oft außerhalb von Arbeitszeit und Büro statt und können deswegen wie Affären wirken, was Spekulationen befördert, es handle sich um mehr als um eine rein professionelle Beziehung – besonders, wenn eine Frau dann befördert wird.«
Sandberg selbst hält die Hindernisse in der Arbeitswelt für weniger gravierend als jene, die Frauen selbst mitbringen. »Der wichtigste Grund dafür, dass Frauen nicht Karriere machen, ist ihr Zuhause. Die meisten Menschen glauben immer noch, dass die Hauptverantwortung für Hausarbeit und Kindererziehung bei den Frauen liege, und die meisten Paare handeln danach – nicht alle.« Das zweite Hemmnis, mit dem Frauen es zu tun bekommen, sind ihre eigenen Schuldgefühle. »Ich selbst habe ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber«, sagt sie, »weil ich so viel Zeit mit Arbeit verbringe.«
In diesem Frühjahr war ich dabei, als Sandberg mit einem Dutzend weiblicher Facebook-Führungskräfte den Women’s Leadership Day vorbereitete, der eine Woche später stattfinden sollte. »Natürlich können wir einander sexistische Horrorgeschichten erzählen«, sagte sie. »Aber so etwas hält Frauen bloß davon ab, ihre eigene Entwicklung in die Hand zu nehmen.« Sie lehnt Quotenregelungen für Frauen strikt ab und ist sogar dagegen, Positionen für qualifizierte Frauen offen zu halten, wenn diese noch in ihrer Elternzeit sind. »Das führt nur zu Zeitverlust, und für Zeitverlust muss man einen Preis bezahlen. Auch die Frau selbst. Schließlich würde man über sie denken, dass sie den Job nicht bekommen hat, weil sie die Beste, sondern weil sie eine Frau ist.« Und sie erzählte von einem Vortrag, den sie in Harvard gehalten hatte. Hinterher hätten die Männer im Publikum professionelle Fragen gestellt, über die Abwehrstrategien von Facebook gegen die Mobilfunk-Offensive von Google; die Frauen hätten sich für Persönliches interessiert, zum Beispiel, wie man es am besten anstelle, einen Mentor zu finden. So etwas nennt Sandberg etwas abschätzig: »Mädchenfragen.«
Deborah Gruenfeld, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Stanford, versteht, warum solche Mädchenfragen gestellt werden. Schließlich verletzen Frauen, die eine Karriere und Führungspositionen anstreben, jenes Stereotyp, das von Frauen erwartet, sich fast mütterlich um den Erfolg anderer zu kümmern statt ihren eigenen im Auge zu haben. Frauen, die als kompetent wahrgenommen werden, sagt Gruenfeld, gelten bei anderen schnell nicht mehr als warm und zugänglich. Sheryl Sandberg selbst ist solcher Nachrede bisher immer entgangen; für Gruenfeld hat das viel mit ihrer Bescheidenheit und Ehrlichkeit zu tun. Sandberg versteckt ihre Ambitionen nicht, aber sie geht auch nicht protzig mit ihnen um. Sie leitet große Meetings, aber sie nennt Mark Zuckerberg dennoch »meinen Boss« und »den Steve Jobs seiner Generation«. Sie ist, sagt Gruenfeld, ein Beispiel für die Generation postfeministischer Frauen, auch in ihrem Glauben, es sei »ein Zeichen von Ohnmacht, jemand anderen für die eigene Position verantwortlich zu machen«.
»Wenn sie wollte, könnte sie jedes Unternehmen leiten«, sagt Mark Zuckerberg über Sandberg, »aber das Bemerkenswerte an Sheryl ist, dass sie sich wirklich die Hände schmutzig machen und arbeiten will, statt ständig im Vordergrund zu stehen. Sie hat kein aufgeblasenes Ego. Sie will Leuten helfen und nicht das Aushängeschild sein.« Howard Schultz, Chef der Coffeeshop-Kette Starbucks, in dessen Verwaltungsrat Sandberg sitzt, sagt: »Wenn man hoch qualifizierte Menschen trifft, neigen die meisten von ihnen dazu zu erzählen, was sie schon alles geschafft haben und wie toll sie sind. Sheryl ist das Gegenteil.« Und Elliot Schrage, bei Facebook unter anderem für globale Kommunikation verantwortlich und enger Vertrauter Sandbergs noch aus Google-Zeiten, sagt: »Die Leute, die ihre Freunde im Job sind, sind es auch privat.«
Genau das gilt normalerweise als ein Management-Fehler. Allzu große Nähe zu Angestellten, heißt es, behindere Objektivität und kompromittiere die Fähigkeit zu harten Entscheidungen. »Dem widerspreche ich entschieden«, sagt Sandberg. »Ich glaube ganz fest daran, dass man seine ganze Persönlichkeit in die Arbeit einbringen sollte. Wenn man sich bemüht, das private Selbst und das professionelle Selbst voneinander abzugrenzen, erreicht man nur eines: Man wird steif. Ich erwarte nicht, dass mir die Menschen ihr Leben erzählen, aber ich selbst teile ziemlich viel von mir mit.« Offen mit Angestellten umzugehen führt dazu, glaubt Sandberg, dass diese von nichts überrascht werden können – selbst wenn man sie feuert.
Alle Fragen über die Zukunft von Facebook betreffen logischerweise auch ihre eigene. Gewiss hat sie das Zeug zur Konzernleiterin, und nicht wenige Beobachter trauen ihr eine politische Karriere zu. Sandberg selbst schüttelt Fragen nach ihren Plänen ab: »Ich bin sehr zufrieden mit Mark und Facebook. Und ich habe mir angewöhnt, mich nicht auf etwas Bestimmtes einzuschießen, weil ich das für einen Fehler halte. Als ich noch am College war, gab es kein Internet, kein Google, kein Facebook. Wer sich heute einen Plan für morgen macht, ist morgen vielleicht auf die Möglichkeiten von heute beschränkt.«
Die Zukunft, mit der sie sich stattdessen im Frühsommer dieses Jahres beschäftigte, war die der Absolventinnen des renommierten Barnard College. Sie hatte sich bereit erklärt, die Abschlussrede zu halten – nach Hillary Clinton 2009 und Meryl Streep 2010. Die Zuhörerinnen ihrer postfeministischen Botschaft waren andere als jene ihrer TED-Ansprache: »Das sind Frauen, die jetzt damit beginnen, die Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Ich werde ihnen sagen, dass sie sich reinhängen sollen.«
Auf dem Rednerpodium sprach Sandberg darüber, wie wichtig es für Frauen sei, sich nicht von Selbstzweifeln davon abhalten zu lassen, etwas zu wollen. »Erinnert euch immer daran«, sagte sie, »dass ihr fantastisch seid!« Dann erzählte sie von einem Poster, das bei Facebook hängt und auf dem steht: »Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?« Darum gehe es für Frauen, sagte Sandberg: »Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Sehnsüchte von Ihren Ängsten besiegt werden. Lassen Sie die Hindernisse, denen Sie im Berufsleben begegnen –und es wird sie geben –, äußerliche Hindernisse sein, nicht innerliche. Das Glück begünstigt die Mutigen. Sie werden nie erfahren, wozu Sie fähig sind, wenn Sie es nicht versuchen. Wenn diese Zeremonie hier vorüber ist und Sie Ihre Abschlusszeugnisse haben, werden Sie Ihr Erwachsenenleben anpacken. Fangen Sie damit an, dass Sie nach den Sternen greifen. Gehen Sie nach Hause, und fragen Sie sich heute vor dem Einschlafen: Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Und dann tun Sie’s. Herzlichen Glückwunsch!«
Man sollte meinen, wer ein Angebot bekommt, im New Yorker porträtiert zu werden, würde freudig annehmen. Doch meist ist das Gegenteil der Fall, so auch bei Sheryl Sandberg: Unser Autor ken auletta – eine Bestätigung dafür, welche Hochachtung ihr in der Firma entgegengebracht wird.
Credits: Erschienen in »The New Yorker«, 11. Juli 2011, Autor: Ken Auletta; aus dem Amerikanischen von Peter Praschl.
Foto: AFP