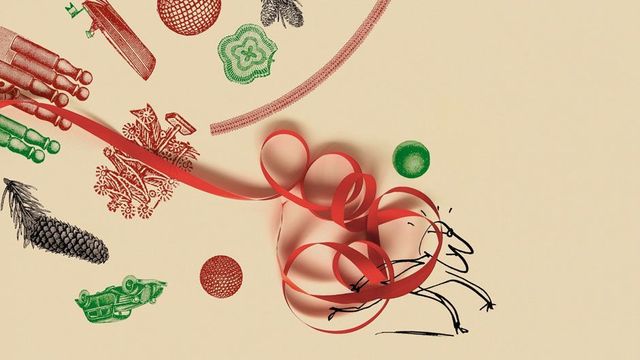Darf man Jesus Christus auch nachträglich zum Geburtstag gratulieren? Ich würde Weihnachten gern erst nach Weihnachten feiern. Wenn alles vorbei ist. Der Stress, der Kitsch, die aufgeblasenen Erwartungen, die nicht einzulösen sind.
Ich habe recht gute Erfahrungen mit dem Nachfeiern von Festen gemacht. Solange ich glaubhaft versichern konnte, dass ich das Datum nicht bloß verschlafen hatte, sondern aus dramaturgischen Gründen mit leichter Verzögerung gratulierte, traf ich bislang immer auf einen wesentlich aufgeräumteren Jubilar, als er es an seinem Geburtstag selbst gewesen wäre. Der folgt doch allzu oft einem blutleeren Ritual, dem Absingen von unpersönlichen Liedern, dem Überreichen von ebensolchen Geschenken, dem mechanischen Anstoßen und Kerzenausblasen. All das wird so artig wie verhuscht absolviert, schon ist der vermeintlich große Tag vorüber, und das Einzige, was von ihm übrig bleibt, ist ein Berg von Abwasch.
Nun ist der Abwasch nichts, was Jesus belasten muss. Dennoch gehe ich davon aus, dass es ihm in all seiner Gnade recht wäre, wenn ein paar Leute ihn ein bisschen später hochleben ließen als der Rest der Christenheit. Ich würde die Nächte des 27. oder 28. Dezember vorschlagen, wenn die Straßen leer und still sind, weil alle schlafen, noch zuckend von den Anstrengungen der Festtage, wie junge Hunde, die vom Jagen träumen. Wenn nicht mehr Jingle Bells aus allen Lautsprechern scheppert und die japanischen Kampfroboter, die die lieben Kleinen bekommen haben, endlich schweigen. Dann könnte ich ganz leise sagen: Frohe Weihnachten. Und alles Gute, lieber Jesus.
Es sei vier Uhr am Morgen, im späten Dezember, singt Leonard Cohen zu Beginn von Famous Blue Raincoat, er setzt sich hin und schreibt seinem Freund einen Brief. Dieses Lied ist für mich, viel mehr als O Tannenbaum oder Ihr Kinderlein kommet, dieser rührselige Blockflöten-Kitsch, das Versprechen auf eine Zeit der Ruhe und Einkehr. Der schlurfenden Erkundungsgänge durch die eigene Wohnung bei Nacht, wenn an den Scheiben der Frost klirrt und sanft der Schein der Laternen hereinfällt. Mit einem Mal ist alles auf magische Weise neu, das Bild an der Wand, das Buch auf dem Tisch, der Stift, das Papier, die Gedanken. Jetzt, genau jetzt könnte ich einen Wunschzettel verfassen, der wirklich von Bedeutung wäre. Was will ich wirklich? Was will ich geben und was empfangen? Ich glaube, ich wüsste es, für einen klaren, kostbaren Moment.

Rote oder grüne Christbaumkugeln? Ente oder Gans? Singen oder fernsehen? Mit oder ohne Schwiegereltern? Weihnachten kann schnell in ein Fest der Streitfragen ausarten.
Ich habe mir das schon oft vorgenommen, aber ich konnte bislang dem Druck der Gruppe nicht standhalten, die auf dem routinemäßigen Abfeiern des Heiligen Abends am 24. Dezember beharrte, vor allem die Kinder erweisen sich als unerbittlich. Ich sah mich also zum wiederholten Male einen Bademantel verschenken, weil mir wieder nichts Besseres eingefallen war, und eine CD von einer Band in Empfang nehmen, die ich nicht einmal im Radio ertrage, das wäre doch nicht nötig gewesen, Tante Ingeborg, ja, bist du denn verrückt, sag mal. Das sogenannte Fest, ein Exzess des Geschenkeaufreißens, der gespielten Freude und der nahtlos ineinander übergehenden Riesenmahlzeiten, war vorüber, ehe ich dafür auch nur annähernd in Stimmung gekommen war. Und statt nun durch die Wohnung zu wandeln, wie ich es mir ausgemalt hatte, staunend über den Neuschnee, durch den noch kein Mensch gegangen war, lag ich schnarchend im Bett, sediert vom Gänsebraten, drei Pfund Plätzchen und der trockenen Heizungsluft in der guten Stube.
Diese Art der Erschöpfung zur Weihnachtszeit nennen die Amerikaner auch »Family Jet Lag«. Sie müssen, wenn sie ihre Familien daheim besuchen wollen, oft in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen und über wenige Tage viele Menschen treffen. Ihre innere Uhr wird dabei durcheinandergebracht, somnambule Geistesabwesenheit ist die Folge, und das zum Fest der Liebe, wie unpassend. Aber auch uns, die wir bestenfalls mal von Berlin nach Quakenbrück fahren oder gleich ganz zu Hause bleiben, überfällt in diesen Tagen eine breiige Müdigkeit. Als wären wir dumme Bären, die kein Quartier für den Winterschlaf gefunden haben und nun verwirrt durch die Gegend stolpern.
Das liegt nicht nur daran, dass Weihnachten stets dann gefeiert werden muss, wenn der Kalender es uns befiehlt, und wir gar nicht genug Kraft dazu haben, am Ende eines wieder mal aufreibenden Jahres. Sondern vor allem daran, dass es so irrsinnig lange dauert, viel länger als drei Tage, drei Monate sogar, würde ich vorsichtig schätzen. Die Weihnachtszeit hat sich bis weit ins Vorfeld hinein ausgeweitet, sie ist wie ein Tanzmarathon, an dessen Ende alle zusammenbrechen und selbst die Sieger sich nicht mehr freuen können, weil sie ohnmächtig geworden sind. Aber die Musik, die läuft gnadenlos weiter.
Mein ganz persönlicher Weihnachtsalarm schrillt meist schon dann, wenn ich eigentlich noch hoffe, dass der Sommer zurückkehrt. Wenn ich noch hoffe, dass er sich überhaupt mal blicken lässt, dieser unstete Freund, nachdem es ja wieder nur geregnet hat den ganzen August über und ich die ein, zwei mickrigen Sonnenstunden im Juli bereits vergessen habe. Die Zeit wird schon knapp und schließlich auch die Hoffnung, und dann, genau dann, knipst im Haus gegenüber mein Nachbar, dieser Unmensch, seinen elektrischen Weihnachtsstern an.
Es geschieht, ich habe Buch darüber geführt, jedes Jahr zwischen dem 10. und 15. September, am ersten Abend, der so kühl ist, dass darauf kein milder mehr folgen wird. Das Licht geht an, und bei mir wird es endgültig dunkel. Ich bin der Astronom eines Sterns, den ich nicht sehen will. Ich hätte wohl einen ziemlich schlechten Weisen aus dem Morgenland abgegeben. Es wird so viel geschimpft über Dominosteine und Lebkuchenherzen, die bereits kurz nach der Ferienzeit in den Supermarktregalen auftauchen, dass das Geschimpfe selbst schon zur Weihnachtsfolklore gehört und es erzlangweilig ist, sich daran zu beteiligen. Immerhin scheint ja eine Nachfrage zu bestehen, irgendwer wird das Zeug schon kaufen und dann bunkern für den atomaren Winter oder sogleich verschlingen, mir doch egal. Für diesen vermaledeiten Weihnachtsstern im Fenster meines Nachbarn aber besteht keinerlei Nachfrage, jedenfalls nicht von mir oder jemandem, der noch ganz bei Trost sein kann. Er ist die pure Beleidigung eines auf Sonnenlicht und ein wenig Wärme Hoffenden, der um den August betrogen worden ist. Das verächtliche Anknipsen dieses Sterns beendet nicht nur den Sommer, sondern überspringt sogar den Herbst. Und kaum dass die Zugvögel wissen, was die Stunde geschlagen hat, ist Weihnachten. Wenn mich dann, meist im Laufe des Oktobers, noch ein kecker Kollege fragt, na, hast du auch schon alle Geschenke besorgt, kommen mir für einen eigentlich recht friedfertigen Zeitgenossen sehr untypische Gedanken.
Nun geht diese zur Unzeit anbrechende Phase zwar mit einem Gemütlichkeitsgebot einher. Ich solle es mir, so wird mir überall suggeriert, schön muckelig machen, in Entspannungsbäder tauchen, die nach Zimt und Tannenzweigen riechen, mich danach in Decken kuscheln und ZDF-Filme schauen, in denen Wotan Wilke Möhring einen Weihnachtsmann spielt, bei dem alles schiefläuft, der deswegen gegen das Lenkrad seines alten Autos hämmert, doch am Ende heiratet er Katja Riemann, und alles wird gut. Doch selbst wenn ich es wollte, könnte ich diesem Gebot beim besten Willen nicht nachkommen, weil ich die ganze Zeit mit den Vorbereitungen für das Fest befasst bin. Entweder passiv, indem ich mich gräme, anders als der kecke Kollege, noch nicht alles auf der Reihe zu haben. Oder aktiv, indem ich kurz vor Geschäftsschluss am 24. Dezember, in meiner Daunenjacke schwitzend, die Rolltreppen von Kaufhäusern hinaufsetze, um noch ein Verzweiflungsgeschenk zu besorgen. Ich fand mich auch schon einmal, ich gestehe es hier, am Heiligen Abend in einer Tankstelle wieder, wo ich eine Schachtel Pralinen erstand, das persönlichste Präsent, das um diese Zeit noch aufzutreiben war.
Durch den Sprühregen, die Fußgängerzone entlang, vorbei an den geschlossenen Bretterbuden des Weihnachtsmarkts, hetze ich dann zum Krippenspiel in die überfüllte Kirche, um vom Vorraum aus Zeuge zu werden, wie der niedliche kleine Darsteller des Josef seinen Text vergisst und weinend in die Sakristei rennt. Ich denke an meinen Nachbarn, der unter seinem Weihnachtsstern sitzt und sich, so stelle ich es mir jedenfalls vor, ganz gemütlich einen Kriegsfilm reinzieht. Auf dem Parkplatz vor der Kirche kommt es nach dem Gottesdienst zu einigen Auffahrunfällen.
Dann gibt es Braten. Sehr viel Braten, der jedoch schnell verzehrt, ja verschlungen werden muss, denn es ist inzwischen schon halb acht am Abend, und es darf keine Zeit mehr verloren werden.

Überdosis Liebe: Der Anspruch, es allen recht zu machen, kann ganz schön stressig sein.
Wenn es endlich zur Bescherung kommt, fühle ich mich so erschlagen von diesem unendlichen Präludium, dass ich auf der Stelle im Sessel einschlafen könnte, mit der halb ausgepackten CD auf dem Schoß. Um mich herum tost ein Meer aus Geschenkpapier, in dem sich zahllose Kinder um ein Piratenschiff streiten, als wären sie Matrosen in der Schlacht von Trafalgar. Onkel Werner, der eine halbe Stunde apathisch auf den Einband eines drei Kilogramm schweren Speziallexikons geblickt hat, ohne es einmal aufzuschlagen, ist mit einem Mal aufgesprungen, als hätte er den Einfall seines Lebens, und macht sich nun am Plattenspieler zu schaffen, um das Weihnachtsalbum von Roger Whittaker zum Laufen zu bringen. Tante Ingeborg bietet mit der gestrengen Zuvorkommenheit einer Nachtschwester weiterhin Plätzchen an, die ich mich nicht abzulehnen traue. Es ist schwer zu sagen, ob es an diesen Plätzchen liegt, auf denen ich pausenlos herumkaue, oder an der massiven Erschöpfung, aber was ich meinen Lieben zu sagen hätte, bringe ich nicht mehr über die Lippen. Ich sage nur noch: Gute Nacht. Oder, weil die Kraft nicht mehr reicht, etwas kürzer: Nacht.
Ist das noch das Fest, auf das ich mich als Kind so gefreut habe? Die Zeit der sogenannten Wunder? Der Weihnachtsstern meines Nachbarn im Fenster des Hauses gegenüber leuchtet wie eine elektrische Grabkerze. Bratensoße schwappt durch meine Venen, enttäuscht falle ich ins Koma.
Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt, so heißt es scherzhaft. Aber ich halte das durchaus für eine sinnvolle Überlegung. Um dieses Fest wieder so neu und magisch werden zu lassen, wie es einmal gewesen sein mag, würde ich es wirklich gern verschieben, auf die Zeit danach. In die Stille hinein, in der ich hören kann, was ich mir wünsche. Auf vier Uhr am Morgen, im späten Dezember.
Illustrationen: Serge Bloch