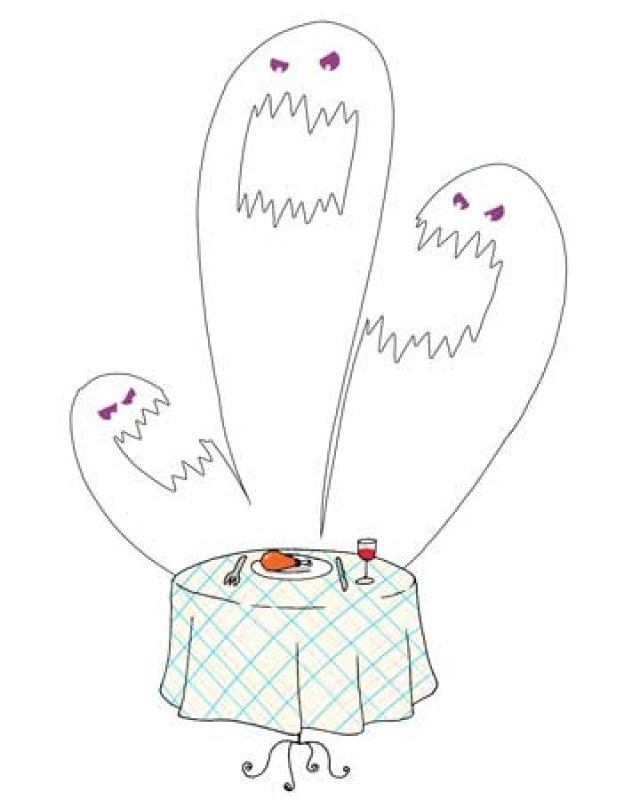Neulich in Italien, am Abend eines Strandtages. Zwei Familien im Restaurant, dabei drei Halbwüchsige, auch der Luis. Wir bestellen eine bistecca für die drei, ein großes Stück Fleisch, dazu Rosmarinkartoffeln. Kaum steht das Essen da, säbelt einer einen Riesenfetzen für sich ab, der Nächste häuft Kartoffeln auf seinen Teller, der Dritte beschimpft die beiden, weil sie ihn nicht ans Futter lassen.
Ermahnungen der Eltern. Bitten. Hinweise. Ein Erwachsener fragt, ob er probieren dürfe. Er bekommt eine mit bloßem Auge kaum erkennbare Fleischfaser gereicht. In kürzester Zeit ist alles vernichtet. Die Frage nach einer Nachspeise wird aufgeworfen.
Ermahnungen der Eltern, die kaum mit dem Essen begonnen haben. Bitten. Hinweise.
Aber er habe nur ein winziges Stück bekommen, ruft einer, die anderen hingegen … Wie man satt werden solle von jenem kleinen Streifen Fleisch, den die beiden anderen ihm überlassen hätten, fragt der Zweite. Die paar Kartoffeln, mault der Dritte.
Ein Stück über die Gier im Alltag. Zuerst waren es alle, hinterher keiner. Die Eltern grübeln über den Prozess der Zivilisierung: wie lange es dauert, bis man Gier im Zaum hat …
Übrigens habe ich früher an diesen italienischen Strandtagen öfter gebadet, im Meer. Ich mag das Meer nicht mehr – warum? Quallen, Fische, die Tiefe? Mir fällt ein, dass ich mit vier Jahren in den Teich meines Onkels fiel. Ich hatte, wie die anderen Kinder, Zweige von einer übers Wasser hängenden Trauerweide abschneiden wollen und das Gleichgewicht verloren. Das Letzte, woran
ich mich erinnere, bevor ich im Dunkel des Teichs versank, war das Entenhaus mitten auf dem Tümpel. Hätte mein Vater mich nicht gerettet, wäre dieses Entenhaus das Letzte gewesen, das ich von der Welt sah …
Kann es sein, dass nach fünfzig Jahren solche Ängste vor dem Wasser, der Tiefe, dem Ertrinken zurückkehren? Dass ich das Meer deshalb fürchte? Ja, dass Ängste sich vererben? Denn auch der Luis sagt plötzlich, er möge das Meerbaden nicht, er bleibe lieber am Strand.
Jedenfalls habe ich, wegen dieser alten Geschichte, eine scharfe Wahrnehmung für alles, was mit Entenhäusern zu tun hat. Ich lese zum Beispiel gerne Berichte über den Skandal im britischen Unterhaus. Dort hat sich, unter anderem, der Abgeordnete Viggers vom Staat das Entenhaus auf einem Teich seines Landsitzes bezahlen lassen, für 1645 Pfund – warum?
Wenn ich alles richtig verstanden habe, konnte man sich als Unterhausmitglied einen Großteil der zur Ausübung des Amtes notwendigen Kosten erstatten lassen, wobei es sich für die Abgeordneten als vorteilhaft erwies, dass die zuständige Behörde nicht allzu streng kontrollierte. Da der Staat die Kosten für den Zweitwohnsitz übernahm, erklärte zum Beispiel mancher Parlamentarier eine Besenkammer in der Londoner Wohnung der Schwester zum Hauptwohnsitz, sein Schlösschen auf dem Land hingegen zum Nebenhaus. So tauchten nicht nur Entenhäuser, sondern auch die Entfernung von Maulwurfshügeln, die Reparatur eines Rasenmähers und das Auswechseln von Glühbirnen auf den Spesenkonten auf, gar die Reinigung des Burggrabens beim Abgeordneten Douglas Hogg, was dem Begriff des Spesenritters eine neue Dimension verleiht.
Unendlich scheinen die Listen von Dingen, welche britische Politiker auf Staatskosten anschafften, man entdeckt dort wunderbarste Gegenstände: eine Elefantenlampe für 134,30 Pfund beim Abgeordneten Michael Gove, die Entfernung eines Wespennestes für 158,63 Pfund im Haus von Patrick McLoughlin. Aber das wahrhaft Faszinierende sind nicht die größeren Beträge; es sind die Kleinigkeiten: eine Tüte Kompost aus getrockneten Pferdeäpfeln für 70, ein Holzkochlöffel für 26, eine Zitrone für 23 Pence. Hundefutter, Waldorfsalat, Mausefallen ...
Der Prozess der Zivilisierung des Menschen: zu Ende ist er nie. Das Erstaunliche ist: In der Finanzkrise lernten wir, welche Riesendimensionen die Gier annehmen kann. Hier aber ist zu erkennen: Sie macht auch vor kleinsten Beträgen nicht Halt.