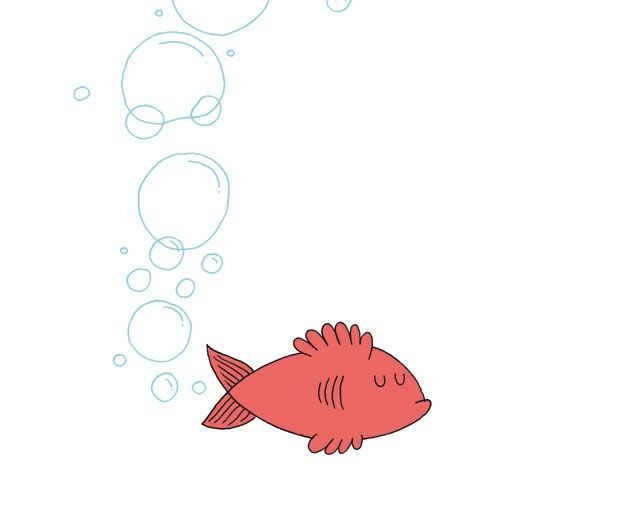Leserin G. schickte Oberst von Huhn das Foto einer Speisekarte aus Spanien: Dort war der Begriff chicken wings, also Hühnerflügel, mit Hühnertragfläche übersetzt worden. Ich empfand Dankbarkeit, dass der Mensch über das Instrument der Sprache verfügt. Es ermöglicht ihm, in ein Lokal zu gehen, um Hühnertragflächen zu bestellen.
Man kann zugunsten der Tiere vorbringen, was man will: Die Sprache erhebt den Menschen auf ein Niveau, das sie nicht erreichen. Wildhunde in Botswana zum Beispiel müssen sich in deutlich kleinerem akustischem Rahmen verständigen. Den Mitteilungen der Royal Society, einer berühmten Gelehrtenvereinigung, konnte man vor einer Weile entnehmen, wie die Wildhunde sich zur Jagd verabreden. Sie niesen.
Das geht so: Liegt ein Wildhundrudel in der Savanne, bekommt irgendwann eines der Mitglieder Appetit. Es beginnt herumzulaufen, seine Genossen zu stupsen. Sind diese lustlos, geschieht nichts. Knurrt aber auch ihr Magen, so niest ein Hund, dann ein weiterer. Hat ein Alphatier zum Aufbruch gebeten, reichen drei Nieser aus der Gruppe, damit alle auf die Pirsch gehen. War es ein Tier von niederem Rang, so müssen etwa zehn Kollegen ein Antwortniesen hervorstoßen, damit sich etwas rührt.
Beim Menschen kennt man diese Art der Kommunikation nur unter Konzertbesuchern, die sich mithilfe von Niesen und Husten über die Qualität des Dargebotenen verständigen. Interessanterweise existiert aber auch bei Tennisspielern die Möglichkeit außersprachlicher Kommunikation. Psychologen der University of Sussex haben Seufzer und Stöhner von Tennisspielern untersucht und ihre Resultate in der Zeitschrift Animal Behaviour (was man tatsächlich mit Tierverhalten übersetzen könnte) dargestellt.
Demzufolge ächzen Athleten, die ein Spiel verlieren, in deutlich höherer Tonlage als jene, die sich auf der Straße des Sieges befinden. Nicht nur das: Spielte man Profis anonymisiert die entsprechenden Geräusche von Kollegen vor, konnten sie mit großer Sicherheit sagen, ob hier ein Sieger oder ein Verlierer seufzte – und dies schon am Beginn eines Matches, nicht erst an dessen Ende.
Ist das nicht phänomenal? Der Mensch kann einerseits seufzen wie ein Tennistier, andererseits genau darüber kluge Abhandlungen verfassen, eine Möglichkeit, die zum Beispiel dem Hering, der im Pazifik lebt, nicht gegeben ist; er ist darauf beschränkt, sich im Schwarm mit Fürzen zu verständigen, die allerdings, so einschlägige Studien, fast acht Sekunden dauern und drei Oktaven umfassen können. So was habe ich beim Menschen zuletzt 1969 im Ferienlager des Jugenderholungswerks Niedersachsen erlebt.
Fische sind übrigens keineswegs so stumm, wie es heißt: Clownfische quietschen, Piranhas krächzen, Lippfische tuten, Karpfen grummeln. Der Mensch aber, Herr der Geräusche, erfüllt seinerseits die Meere mit einem solchen Lärm – vor allem aus Schiffsmotoren –, dass Fische dagegen einfach nicht mehr, verzeihen Sie!, anfurzen können. Sie verstehen sich nicht mehr. Beispielsweise verursachen Airguns, mit deren Hilfe man den Meeresgrund nach Bodenschätzen untersucht, Explosionsgeräusche im Bereich von 300 Hertz. Das ist genau der Bereich, in dem sich Blau- und Finnwale (keine Fische, ich weiß!) verständigen – oder eben nicht, weil sie sich nicht mehr hören können.
Immer weniger Wale finden zueinander. Sie vereinsamen. Der Mensch zerbombt also auch die Kontaktmöglichkeiten der Meerestiere. Andererseits kann er sich darüber, wie das zu ändern wäre, sprachlich verständigen und eine Lösung finden. Hofft man irgendwie.
Tja.
Ob man in Spanien statt Hühnertragflächen auch Hühnerfittiche verlangen könnte? Oder Hühnerschwingen?
Illustration: Dirk Schmidt