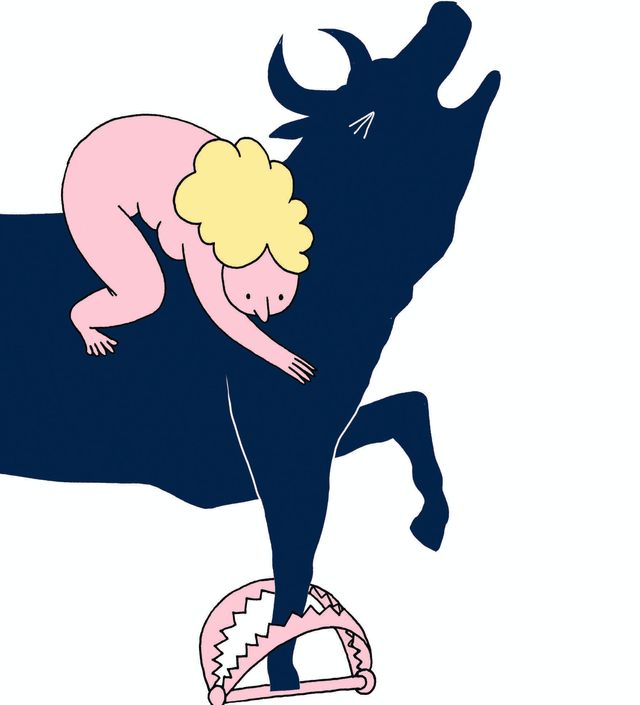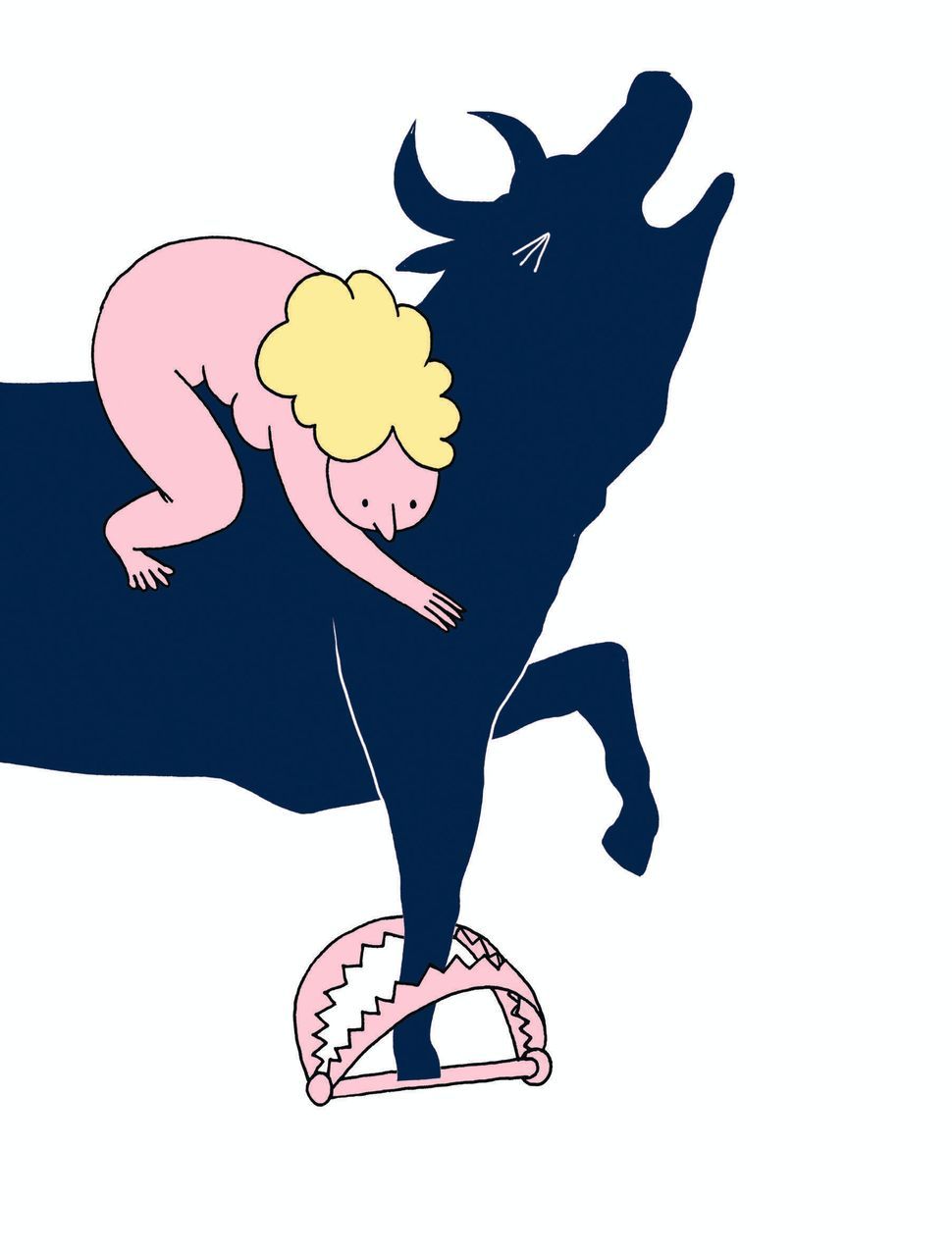Der Zeitungsladen in dem italienischen Dorf, in dem ich viel Zeit verbringe, befand sich bis vor einigen Jahren im Zentrum, mehr noch: Er war das Zentrum. Kaufte man morgens eine Zeitung, musste man sich seinen Weg durch einander begrüßende, scherzende, diskutierende Menschen bahnen, die auch alle eine Zeitung kauften.
Heute befindet sich dort ein Parfüm-Geschäft, in dem man selten Kunden sieht.
Das neue Zeitungsgeschäft ist um die Ecke, in einer stillen Gasse. Es geht dort ruhiger zu als im alten Laden; die Italiener lesen weniger Zeitung, nicht anders als die Deutschen. Die Zeitungshändlerin, die so mutig war, einen Kiosk zu eröffnen, sagt: »In Italien geht es nur um das Ich. Immer: ich, ich, ich. Jeder denkt an sich und die Familie, keiner mehr ans Wir, den Staat, uns alle zusammen.«
In der Repubblica lese ich den Leitartikel. »Der Tag der einfachen und schnellen Lösungen ist da«, schreibt der Chefredakteur. Wer arbeitslos sei, erhoffe von der neuen Regierung das Bürger-Einkommen, die Rentner erwarteten eine Renten-Erhöhung, andere zählten das Geld, das sie durch eine Steuersenkung sparten, Impfgegner ersehnten das Ende der Impfpflicht, und wer gegen Migranten sei, wolle weniger von denen auf der Straße sehen. Jeder denkt an sich, keiner an alle.
In Italien ist das Ichichich die Folge der Jahrzehnte, in denen Silvio Berlusconi das Land prägte: der Ministerpräsident als oberster Egomane, der seine Zeit darauf verwendete, sich zu bereichern und zu amüsieren. Jene, die eine übergeordnete Idee für das Zusammenleben hatten – Sozialdemokraten, Katholiken, Liberale –, sind verschwunden zugunsten eines Populismus, der keine zusammenhängenden Gedanken formuliert, sondern aus Geschrei besteht.
Aber war nicht schon die oft wiederholte Wahl von Berlusconi die Folge der Tatsache, dass die Italiener keine Hoffnung mehr in ihren Staat setzten? Dass sie nichts mehr von ihm erwarteten? Dass sie lernen mussten, dass jeder von ihnen nur eine Chance hatte, wenn er sich auf sich selbst und seine Familie verließ? Dass also jene, die man heute vermisst (Sozialdemokraten, Katholiken, Liberale) nicht immer in der Lage waren, ein funktionierendes, den Bürgern dienendes Gemeinwesen zu organisieren?
Es ist leicht, sich jetzt vor den italienischen Populisten zu fürchten, weil sie möglicherweise unser schönes Europa zum Einsturz bringen.
Aber wichtiger wäre, aus ihrem Aufstieg zu lernen, zum Beispiel: dass ein demokratischer Staat schlicht und einfach auch funktionieren muss, weil nämlich die Bürger ihn sonst nicht akzeptieren. Und dass »Europa« schon jedem Einzelnen vermitteln sollte, wie es ihm nützt. Es ist nicht ganz leicht, einem italienischen Maurer die Ideale der EU zu erklären, wenn ihm gerade ein rumänischer Kollege den Job weggeschnappt hat, weil er billiger arbeitet. Es ist auch schwierig, sich über junge Arbeitslose im Süden zu erheben, die 780 Euro reddito di cittadinanza erhoffen, einen Bürgerlohn, weil es in Italien nicht einmal so etwas wie Hartz IV gibt. Und es ist übrigens kaum möglich, das Geschimpfe eines Deutschen über Italiener als aggressive Schnorrer, die sparen und arbeiten sollen, von Matteo Salvinis Populismus zu unterscheiden.
Blöd ist halt: Italiens Probleme (mit den Flüchtlingen aus Afrika zum Beispiel) waren uns lange egal. Sie sind uns erst dann nicht mehr gleichgültig, wenn es uns ans Geld geht. Ist es nicht so, dass die Deutschen immer noch mehr für Europa sind als andere, weil sie mehr davon profitieren als andere?
»Jeder spielt sein Spiel und achtet nur darauf. Das ist die moderne Politik, aus Einzelinteressen gemacht, unter Preisgabe kollektiver Hoffnungen«, lese ich im Leitartikel der Repubblica.
Was wir aus Italien lernen können? Vielleicht, dass wir eine Antwort auf die Frage brauchen: Was, bitte, sind unsere kollektiven Hoffnungen?