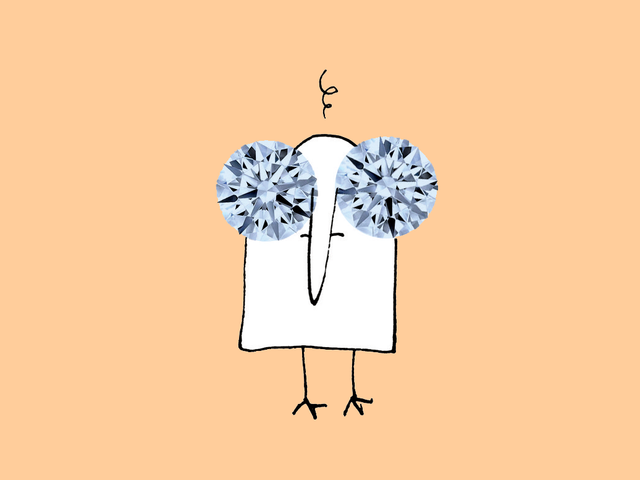2012
Sascha war 33 Jahre alt, als er die Diagnose Asperger-Autismus bekam. Als er offiziell erfuhr, nicht »neurotypisch«, wie es so schön heißt, zu sein. Er verspürte Erleichterung. Weil er endlich eine Erklärung dafür hatte, warum er ein Leben lang das Gefühl hatte, in ein Korsett von Normalität gepresst zu werden, in das er nicht passte. Weil er nun auch die Hoffnung hatte, lernen zu können, mit seinem Anderssein umzugehen, in der »normalen« Welt zurechtzukommen. Sieben Wochen lang sollte er sich dies in einer intensiven stationären Therapie aneignen. Sieben Wochen lang gingen Ärzte und Therapeuten dem auf die Spur, was Saschas Leben beherrschte, solange er denken konnte: seine Impulsausbrüche ausgelöst durch Reizüberflutungen ohne Rückzugsmöglichkeit. Overloads, wie viele Menschen mit Autismus dieses Phänomen nennen. Das innere Fass füllt sich immer mehr, bis es schließlich überläuft. Was mit Sascha dann passiert, sieht von außen aus wie ein Wutausbruch, ist aber ein Ausdruck der tiefen inneren Verzweiflung, die ihn in diesem Moment beherrscht und die er nicht anders bewältigen kann. Bei Sascha spielen ADHS und Autismus zusammen. Das, was sich in ihm anstaut, in ihm rumort und ihm als Menschen mit Autismus zu schaffen macht, entlädt sich vermutlich durch das ADHS besonders heftig und unberechenbar.
Manche Menschen mit Autismus reagieren mit einer Unterempfindlichkeit auf Sinneseindrücke, andere – wie Sascha – werden durch eine Überempfindlichkeit geradezu geflutet von Reizen. Ein Zuviel an Geräuschen, an Gerüchen, an Bildern. Eine summende Biene, ein plärrendes Kind. Ärger über den Pulli, der auf dem Boden liegt, Wut über die Tochter, die zu spät zum Essen kommt. Alles also, was das Leben in einer sechsköpfigen Familie so mit sich bringt. Und all das sammelt sich, staut sich auf – bis Sascha schließlich explodiert. »In diesem Moment kann ich nichts fühlen«, sagt er.
Um die Leere mit Gefühlen zu füllen, sucht Sascha die Extreme. Er springt in eisige Seen, er gießt sich kochendes Wasser über die Hand. Er läuft zwanzig Kilometer, besteigt Berge, mitten in der Nacht. In der Verhaltenstherapie sollte er nun lernen, wie er die Anspannung anderweitig loswerden kann, zusätzlich bekam er Medikamente, die helfen sollten, seine Impulsausbrüche zu unterdrücken.

Eine verrückt normale Familie: Mutter Tanja, Vater Sascha. Er fand mit 33 Jahren heraus, Autismus zu haben. Luis, 11 (ganz links), gilt als vom Autismus schwer betroffen, bei Hannah, 10 (vorne links), ist das Syndrom etwas schwächer ausgeprägt. James, 6 (vorne Mitte), hat ADHS. Jennifer, 17 (vorne rechts), ist Tanjas Tochter aus einer früheren Beziehung und, wie sie, »neurotypisch«.
Illustration: Paula Bulling
»Sieben Wochen lang war ich wie im Glashaus«, sagt Sascha. »Und als ich wieder daheim war, musste es wieder weitergehen.« Aufenthalte in der Psychiatrie können für Betroffene eine Chance sein, um sich einmal ganz auf sich selbst zu konzentrieren – ohne Ablenkung von außen. Gerade wenn sie, wie Sascha, die Diagnose Autismus spät im Leben erhalten haben. Doch irgendwann kommt er eben doch wieder, der Sprung zurück in den Alltag. Dort musste er wieder funktionieren, aber konnte er das?
Zurück zuhause fiel Tanja auf: Ihr Mann war anders als sonst, ruhiger. Er zog sich zurück, wirkte gefühlskalt. Er warf nicht mit Gegenständen herum, brüllte nicht mehr. War nicht gelassener, auch nicht glücklicher. Im Gegenteil, er wirkte depressiv, verzweifelt. Eine Folge der Therapie?
Sechs Wochen nach seiner Heimkehr saßen sie abends zusammen auf dem Sofa, als er lapidar meinte: »Ich hab ein paar Tabletten zu viel genommen.« Ihm waren verschiedene Antidepressiva verschrieben worden, die seine Impulsausbrüche unterdrücken sollten. Von diesen Tabletten habe er sich gerade eine Handvoll eingeschmissen, erklärte er.
Sascha war unberechenbar geworden. Führten die Overloads früher zu Impulsausbrüchen, hatten sie nun eines zur Folge: Impulssuizid.
Tanja sah ihren Mann entgeistert an. Sascha saß entspannt auf dem Sofa, schien sich der Tragweite dessen, was er gesagt und angeblich getan hatte, kaum bewusst zu sein. »Glaub ich ihm oder glaub ich ihm nicht?«, fragte sich Tanja. »Und was, wenn ich ihm nicht glaube, und es doch stimmt?« Sie rief einen Krankenwagen. Sascha kam auf die Intensivstation. Nach drei Tagen wurde er entlassen – ohne eine Erklärung von den Ärzten, und auch ohne dass er selbst eine Erklärung für diesen plötzlichen Impuls gehabt hätte. Sascha war wieder zuhause, alles schien wie zuvor.
Wenige Wochen später: der zweite Suizidversuch. Wieder eine Überdosis Tabletten, wieder Intensivstation. Nachdem ihm der Magen ausgepumpt worden war, wurde er in die Psychiatrie vor Ort verlegt. Dort nahm man ihm sämtliche Medikamente weg, setzte ihn auf kalten Entzug. »Das war wie Messerstiche im Kopf«, sagt Sascha. »Ich musste mich permanent übergeben, meine Gedanken spielten verrückt.«
Ein paar Tage nach seiner Einweisung kam Tanja in die Krankenhaus-Cafeteria, sah ihren Mann zusammengesackt auf einem Plastikstuhl sitzen und weinen. Der Schatten jenes Menschen, der er gewesen war. Tanja ergriff die Initiative, rief in der Klinik an, in der Sascha nach seiner Diagnose stationär behandelt worden war und die Medikamente verschrieben bekommen hatte. Dort äußerten die Ärzte den Verdacht, dass die Suizidgedanken durch eben diese Medikamente ausgelöst sein worden könnten. Was Tanja und Sascha erst jetzt erfuhren: Eine Nebenwirkung eines bestimmten Antidepressivum, das er nahm, waren: Depressionen.
Man riet Tanja am Telefon, Sascha auf eigenes Risiko und gegen den Willen der Ärzte vor Ort zu entlassen, verschrieb ihm neue Medikamente, um die Entzugssymptome zu stoppen. Zuhause begann die Zeit, die Tanja heute als die schlimmste Zeit ihres Lebens beschreibt: Denn Sascha war unberechenbar geworden. Führten die Overloads früher zu Impulsausbrüchen, hatten sie nun eines zur Folge: Impulssuizid.
Tanja wusste nie, wann es wieder soweit sein konnte. Die Tabletten sollten helfen, die Anspannung, mit der er auf Wut, Stress und Reizüberflutung reagierte, zu lösen. Das taten sie auch – doch bei Sascha in solch radikaler Form, dass die Anspannung zu einer Mischung aus depressiver Gleichgültigkeit und verzweifeltem Handlungsbedürfnis verschwamm.
Fünf Suizidversuche in anderthalb Jahren überlebte Sascha. Einmal wollte er sich von einem Viadukt stürzen, besann sich im letzten Moment. Ein anderes Mal wartete er in der Praxis des Hausarztes, verschwand auf der Toilette und schluckte alle Tabletten, die er bei sich hatte. Ernsthafte Absicht oder Hilferuf? Tanja vermutete: Letzteres. Doch so häufig es nun geschah, war sie sich nicht mehr sicher. Sascha wurde zum Arzt hereingerufen, legte kommentarlos die leere Packung auf den Tisch. Der Arzt verstand sofort, brachte ihn schleunigst ins Krankenhaus. Auf eigene Faust dosierten Sascha und Tanja die Medikamente nun herunter, nahmen die qualvollen Nebenwirkungen in Kauf.
»Ich konnte nicht mehr essen«, sagt Sascha.
»Er hing nur noch auf dem Klo«, sagt Tanja.
»Ich konnte nicht mehr denken«, sagt Sascha.
»Er war wie ferngesteuert«, sagt Tanja.
2013
Nach Monaten der Hölle normalisierten sich Kopf und Körper langsam. Bis einem Arzt ein Fehler unterlief und er unbemerkt eine wieder zu hohe Dosis verschrieb. Tanja holte an diesem Tag die Kinder vom Kindergarten ab. Als sie nachhause kam, hatte Sascha sich im Schlafzimmer verbarrikadiert. Sie fand die leere Tablettenschachtel, lockte Sascha heraus und rief den Krankenwagen. Als der kam, hatte es sich Sascha gerade auf der Terrasse gemütlich gemacht und sah keinen Grund, sein Plätzchen dort zu verlassen. »Nö«, sagte er, als die Sanitäter ihn aufforderten, mitzufahren.
»Wenn Ihr Mann nicht will …«, antworteten diese. Nun reichte es Tanja. Kurz vorher hatten sie eine offizielle Betreuung beantragt, damit Tanja ihren Mann bei Behördengängen entlasten konnte. Am ganzen Körper zitternd rannte sie ins Arbeitszimmer, holte den Ordner, legte das Dokument auf den Tisch und sagte: »Ich bin seine Betreuerin, Sie nehmen ihn jetzt mit!« Daraufhin wurden die Sanitäter förmlich und erklärten Sascha: »Wenn Sie nicht mitkommen, holen wir die Polizei.« Tanja flehte Sascha an: »Bitte, bitte, fahr einfach mit.« Er fuhr mit. Und bereute schon im Krankenhaus, seine Frau so verletzt zu haben, sie einmal mehr in einen solchen Abgrund gejagt zu haben.
Doch das Schlimmste für Tanja war es, nach Hause zu kommen. Die Kinder auf dem Sofa sitzen zu sehen, um den Vater bangend, ängstlich, weil sie nicht verstanden, was los war. Und versuchen zu müssen, ihnen das, was sie selbst noch nicht so richtig verstanden hatte, irgendwie zu erklären: »Dem Papa geht’s gerade nicht so gut…«
Wie sollte ihr Leben als Großfamilie weitergehen – mit der ständigen Angst, dass Saschas Impulsausbrüche irgendwann doch zum Äußersten führen würden? Mit Luis’ und Hannahs stärker zu Tage tretendem Autismus? Den Schwierigkeiten in Schule und Kindergarten? Und dann war da ja noch James, der nicht geplante Nachzügler. Und die Angst davor: Würde auch er bald die ersten Anzeichen von Autismus zeigen? Schafften sie das alles?
Folge 1: Wenn dir dein Kind ein Rätsel ist
Folge 2: »Macke oder Manie? Egal, dieser Mann ist mein Retter«
Folge 3: Tanja und Sascha: Die Geschichte einer besonderen Beziehung
Folge 4: »Ich habe ein paar Tabletten zuviel genommen« – Als Autismus für Familie B. zum Albtraum wurde
Folge 5: »Wir sitzen im Wohnzimmer und schicken uns WhatsApp« – Familienalltag mit Autismus
Folge 6: Kämpfen bis zur Selbstaufgabe – Als Tanja nicht mehr konnte und Sascha über sich hinauswuchs
Folge 7: Vierzig Jobs, immer angeeckt - Sascha und das Arbeitsleben
Folge 8: Wir und die anderen – So reagieren Freunde und Nachbarn