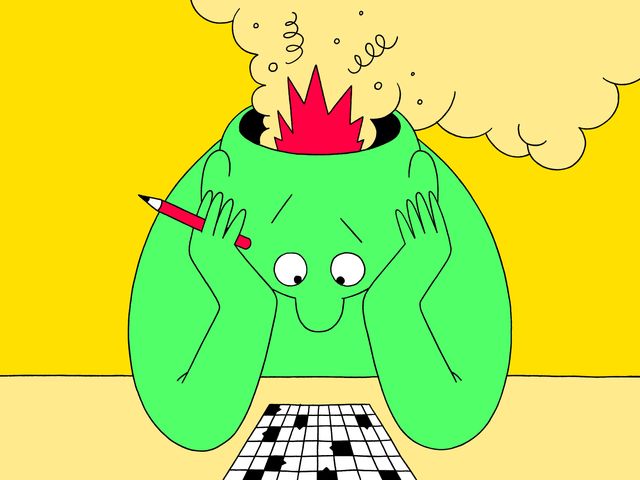Ich bin ein Kind der Siebziger und in einem durch und durch sozialdemokratischen Haus aufgewachsen. Mittags kamen Suppen auf den Tisch, abends Brot mit Käse, am Wochenende auch mal Fisch oder Fleisch, sonntagmorgens, wenn mein Vater total verrückt drauf war, belegte er die Toasts mit falschem Lachs und Kaviar. Zu trinken gab es Mineralwasser oder Apfelsaft. Wenn ich mal Zitronenlimonade trinken durfte, war das für mich ein Riesenerfolg, eine Softdrinkorgie. Die gab es in zwei Varianten.
Variante eins: Sommer, abends, Terrasse. Meine Mutter faltete am Telefon irgendwen zusammen, mein Vater rauchte derweil heimlich. Es war alles sehr friedlich. Ich war damals total ausgefuchst, ergriff eine Chance, wenn ich sie witterte (passiert mir heute eher selten).
»Papa?«
»Hm?«
»Darf ich eine Limo?«
»Du weißt ja, wo das Zeug steht.«
Okay, super. Gleichzeitig auch hochproblematisch, denn die Zitronenlimonade stand im Keller, und seit ich Wir pfeifen auf den Gurkenkönig von Christine Nöstlinger gelesen hatte, hoffte ich einerseits sehr, im Keller einen gemeinen Gurkenkönig zu treffen, um ihm tierisch den Marsch zu blasen, andererseits hatte ich große Angst davor, einen gemeinen Gurkenkönig zu treffen, weil, hey: Gurkenkönig. Gemein. Natürlich riss ich mich trotzdem zusammen und traute mich (laut singend) in den Keller, ich wollte ja an den Zucker. Gurkenkönige waren nie da, aber immer eine Kiste mit Zitronenlimonade. Sie stand links unterm Regal mit den eingemachten Früchten, Rumtopf und so. Keine besondere Marke, einfach samstags im nächsten Getränkemarkt gekauft, auf dem Etikett waren zwei lachende Zitronen zu sehen, vermutlich stand tatsächlich so was wie »Zitronenlimonade« drauf. Ich zog eine Flasche raus, rettete mich mit einem Sprint zurück auf die Terrasse und trank die Limonade in großen Schlucken aus, eine ganze verdammte Flasche.
Zitronenlimonadenvariante zwei: ein Wirtshaus irgendwo im Spessart, meine Eltern und ich waren wandern, vermutlich mit Freunden meiner Eltern, im besten Fall waren noch ein, zwei andere Kinder dabei. Nach der Wanderung ging das Gesitze im Wirtshaus los, mit Schinkenbroten und Bier und dem ganzen Zeug, und da durften wir Kinder dann auch ein bisschen auf den Putz hauen, beziehungsweise süße Getränke bestellen. Boah, wie gern hätte ich mal eine Fanta oder Bluna oder Mirinda getrunken, wie gern wäre ich so posh gewesen wie zum Beispiel die Kinder am Nebentisch, aber Orangenlimonade, Gott bewahre.
Orangenlimonade kam im Wertesystem meiner Eltern nicht gut weg. »Ami-Scheiße«, sagte mein Vater, so wie er zu allem, was ihm zu kapitalistisch vorkam, »Ami-Scheiße« sagte. Orangenlimonade war für ihn gleichbedeutend mit Fanta, und Fanta war Coca-Cola, und – nun, ich erwähnte es. Um nicht zu neidisch auf die Fanta-Bluna-Mirinda-Kinder zu sein, die ja offenbar alles durften, erklärte ich sie zu hochnäsigen Volldeppen und bildete mir ein, ihre Eltern hätten da, wo bei meinen das Herz saß, einen Geldautomaten.
Wenn mein elfjähriger Sohn nach der Schule seine Freundin auf Pommes und eine Limo in den Imbiss einlädt, bekommt er ungefragt Orangenlimonade hingestellt, weil er findet, Orangenlimonade habe »mehr Style«, und deshalb seit Jahren ausschließlich Orangenlimonade ordert. Mein Gesicht dann: unbezahlbar.