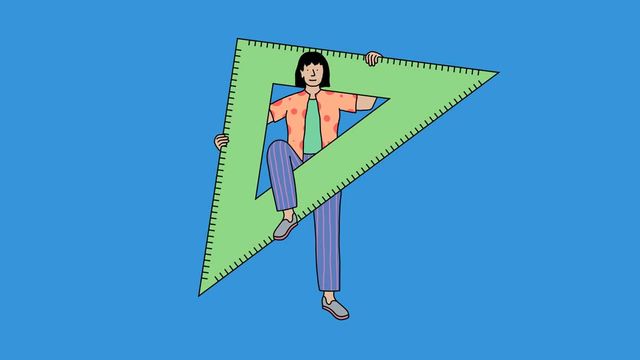Es war ein anstrengender Vormittag gewesen, in meiner Fünften hatten sich zwei Kandidaten in der Pause geprügelt und ich hatte schlichten müssen. Nun freute ich mich auf mein Mittagessen in der Mensa. Wahrscheinlich gab es wieder etwas Weichgekochtes mit wenig Geschmack, egal, am Nachmittag erwarteten mich noch drei Stunden Fachkonferenzen.
Mit einem großen Loch im Bauch und einem vollen Tablett setzte ich mich zur Kollegin Z. in die Spätsommersonne auf die Terrasse. Vielleicht würde das ja doch noch ein schöner Tag werden, dachte ich, bis Frau Z. anfing, genervt von einem ihrer Schüler zu erzählen. Er brauche immer viel zu lange, um mit den Aufgaben in Mathe fertig zu werden, seine Antworten könne sie nie lesen und richtig mitmachen würde er auch nicht. Der Schüler habe Legasthenie. Nicht nur die Anführungszeichen, die sie jetzt über ihrem Essen in die Luft malte, machten deutlich, dass sie zwar erkannte, dass der Junge ein Problem hat, dass sie aber nicht wirklich davon überzeugt war, dass er wirklich ein Problem hat.
Z. ist nicht die Einzige: Noch immer gibt es KollegInnen, die der Meinung waren, dass Legasthenie nur eine Ausrede für nicht ganz so begabte SchülerInnen sei, um mehr Zeit in den Leistungsnachweisen rauszuschlagen. Dass die Schreib- und Lesestörung aber eine schwerwiegende und folgenreiche Einschränkung ist, die zu einem großen Teil genetisch bedingt ist, wollen manche einfach nicht akzeptieren und belächeln regelmäßig die Studien und psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse.
Natürlich hatte auch ich schon die Erfahrung gemacht, dass unterschiedliche Leistungsniveaus einen reibungslosen Unterricht erschweren*, aber das hieß ja nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Ich erzählte Frau Z. von meinem Schüler Dominik, der die Schule vor den Sommerferien verlassen musste, da seine Noten in Deutsch, Mathe und Englisch nicht für die nächste Jahrgangsstufe ausgereicht hatten. Dominik war schlau, eloquent und auf Zack gewesen. In meiner Sechsten war er der einzige gewesen, der meine oft ironischen Bemerkungen aufgreifen und schlagfertig erwidern konnte. Er hatte für sein Alter brillant diskutieren können. Auch sozial war er ein feiner Kerl. Nur hatte Dominik es leider nicht geschafft, ein Notenbild zu erarbeiten, mit dem er dauerhaft an einem bayerischen Gymnasium bestehen konnte.
Kollegin Z. schüttelte den Kopf: »Aber der Junge hat doch alle Maßnahmen erhalten, die ihm das Leben in der Schule leichter machen, und es trotzdem nicht gepackt.« Klar, Dominik hatte, wie alle SchülerInnen mit Legasthenie, einen für ihn vom Psychologen ausgerechneten Zeitzuschlag erhalten – in seinem Fall zwanzig Prozent bei schriftlichen Leistungsnachweisen. Ja, er hatte Texte auf DIN A3 vergrößert bekommen und auch seine Rechtschreibung wurde in den Sprachen nicht in die Notengebung miteingebunden, doch das hatte nicht gereicht.
Sein Selbstbewusstsein war mit jeder Schulaufgabe und Stegreifaufgabe kleiner geworden. Ich konnte quasi dabei zusehen. Ab dem zweiten Halbjahr verließ ihn völlig die Lust, er machte einfach nicht mehr mit. Seine Eltern eröffneten mir in der Sprechstunde, dass sie ihn gerne auf die Realschule schicken würden. Ich hatte meine Zweifel, meinte, erstmal müsse Dominiks Selbstbewusstsein nach sechs Jahren Kampf wieder gestärkt werden, damit er überhaupt einen Abschluss machen könne. An einer alternativen Schule könnte er individueller gefördert werden, schlug ich vor. Doch die Vorstellung, dass ihr Sohn etwa auf eine Montessorischule geht, war für die Eltern undenkbar, eine Schande. Am Ende nahmen sie ihn vom Gymnasium. »Wenn fähige Schüler belächelt werden und so abschmieren, möchte ich am liebsten alles hinschmeißen!«, sagte ich zu Frau Z. und war selbst ein wenig erschrocken, wie viel Frust auf einmal aus mir sprach.
Mein Kartoffelpuffer lag traurig auf meinem Teller rum. Mir war der Appetit vergangen. Frau Z. nippte an ihrem Eistee, sagte nichts. Ich redete mich weiter in Rage. Klagte über das System, das nicht ausgereift sei, um auf solche besonderen Schüler angemessen und einfühlsam einzugehen, genauso wenig wie auf Schüler mit Autismus, Hochbegabung, körperlich Behinderte oder Kinder mit psychischen Problemen. Ich hatte es satt, als Lehrerin primär dafür zuständig zu sein, serienmäßig und in großer Stückzahl Durchschnittsabiturienten für den Arbeitsmarkt zu produzieren. Wie viele besondere, begabte Kinder im Zuge dieser Bildungsindustrie auf der Strecke blieben. Kinder wie Dominik...
Frau Z. schaute mich mit großen Augen an. Irgendwie hatten wir uns unser Mittagessen anders vorgestellt. Sie stand auf, nahm ihr Tablett »Ach, du solltest nicht zu schwarz sehen für deinen Dominik«, sagte sie, »dieser Prinz da aus Schweden, der hat auch Legasthenie und aus dem ist doch auch was geworden.« Es sollte ein Witz sein, ein lockerer Spruch, um diesem verkorksten Mittagessen ein versöhnliches Ende zu geben, aber mir war zum Heulen zumute.
*) In einer früheren Version des Textes war hier von »Sonderbehandlung« die Rede – ein unpassender Begriff in diesem Zusammenhang. Danke für den Leserhinweis!