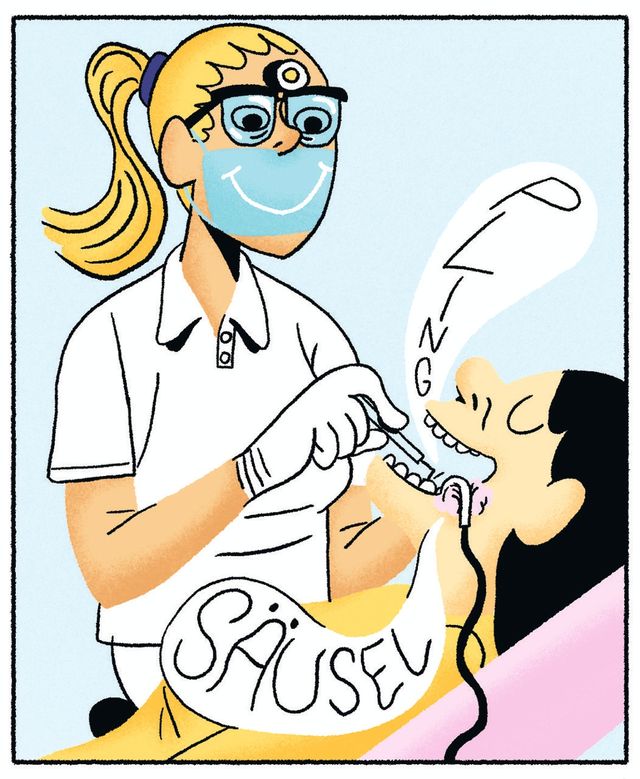Die Galanterie ist zurück in meinem Leben. Allerdings nicht in Form von aufgehaltenen Türen oder Jacken, in die mir jemand hineinhilft, sondern in Form einer einfachen Frage. Im Kern besteht sie nur aus zwei Worten, und doch steckt alles in ihr drin: Mitgefühl und Zugewandtheit, Zurückhaltung und Respekt. Die Kurzform lautet: »Darf ich?«
Zum ersten Mal wurde sie mir vor ein paar Wochen von meiner neuen Zahnärztin gestellt. Die Frage traf mich unvorbereitet: »Darf ich mir den Zahn mal anschauen?« Kein zupackendes: Dann schau ich mir den Zahn mal an! Kein verallgemeinerndes: Dann wollen wir uns den Zahn mal anschauen! Sie fragte einfach ganz offen und höflich, ob sie dürfe, und deutete auf meinen Mund – etwa so, wie das eine Kellnerin fragt, die einem über die Schulter langt, um Wein nachzuschenken, oder ein Friseur, kurz bevor er einem den Umhang umlegt.
Ich antwortete »Ja«. Sie hatte sicher auch kein »Nein« erwartet, im Grunde ist die Frage rhetorisch, jedenfalls wenn man sich freiwillig in eine Arztpraxis begibt. Überflüssig ist sie trotzdem nicht. Durch das »Darf ich?« bekam der Besuch bei meiner neuen Zahnärztin einen gewissen Wellness-Anstrich, was weit entfernt ist von der Realität, mir aber ein gutes Gefühl gab. Wahrscheinlich war genau das ihr Ansinnen gewesen. Ihre Frage verwandelte meine Abwehr in Neugierde: Wer war diese freundliche Frau, und wieso hatte mich vorher noch nie eine Ärztin um Erlaubnis gefragt?
Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, dass es eben das war, was mir bei ihrer Vorgängerin gefehlt hatte: die Nachfrage, ob sie das, was sie da in meinem Mund veranstaltet, auch wirklich darf. Die letzte Behandlung bei meiner früheren Zahnärztin hatte ich mit den traurigtrotzigen Worten »Ich will nach Hause« abbrechen müssen. Ohne Betäubung waren die Schmerzen beim Abfüllen der Wurzelkanäle schier unaushaltbar gewesen.
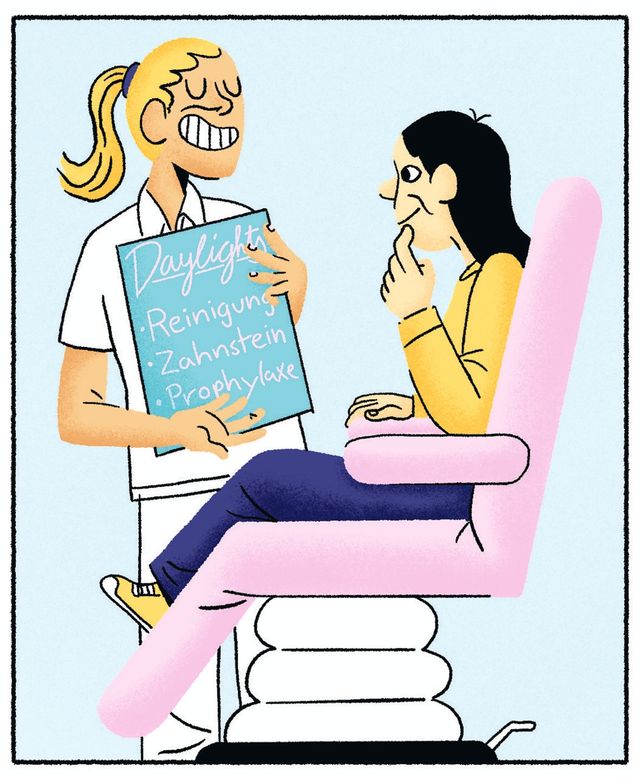
Illustration: Marvin Traber
»Ich will nach Hause«, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon auf irgendwelchen Arztstühlen gedacht habe. Zu oft. Ausgesprochen hatte ich ihn bis dato trotzdem nie. Mein Kind fängt an zu schreien, wenn es sich nicht gut behandelt fühlt und nach Hause will. Zum Beispiel, wenn sein Kinderarzt ohne zu fragen seinen Kopf zur Seite reißt, um seine Bindehaut zu begutachten. Auch da hätte ein einfaches »Darf ich?«, gepaart mit ein wenig Dutzidutzischaumaldieklötze, Wunder gewirkt, da bin ich mir sicher.
Wer krank ist, braucht Hilfe, fühlt sich vielleicht sogar hilflos. Die ärztliche Autorität kann einen in diesen Momenten leicht überfordern, dementsprechend gleicht jeder Besuch in der Arztpraxis unweigerlich einer Übung in Vertrauen. Zumal fast jede Untersuchung eine Grenzüberschreitung nötig macht. Kranksein macht schwach, und je verletzlicher ein Mensch sich fühlt, desto wichtiger ist eine Ansprache auf Augenhöhe.
Vor allem weil jede Frage, die bejaht werden kann, und sei sie auch noch so rhetorisch gemeint, natürlich auch mit »Nein« beantwortet werden kann. Und »Nein«, das hätte ich in meinem Leben in Arztpraxen schon viel häufiger sagen sollen. Nein, fassen Sie mich nicht an, ich fühle mich unwohl. Nein, Sie dürfen mich nicht untersuchen, ich habe das Gefühl, Sie nehmen mich nicht ernst. Nein, nein, nein, ich will nach Hause und mir lieber einen anderen Arzt suchen.
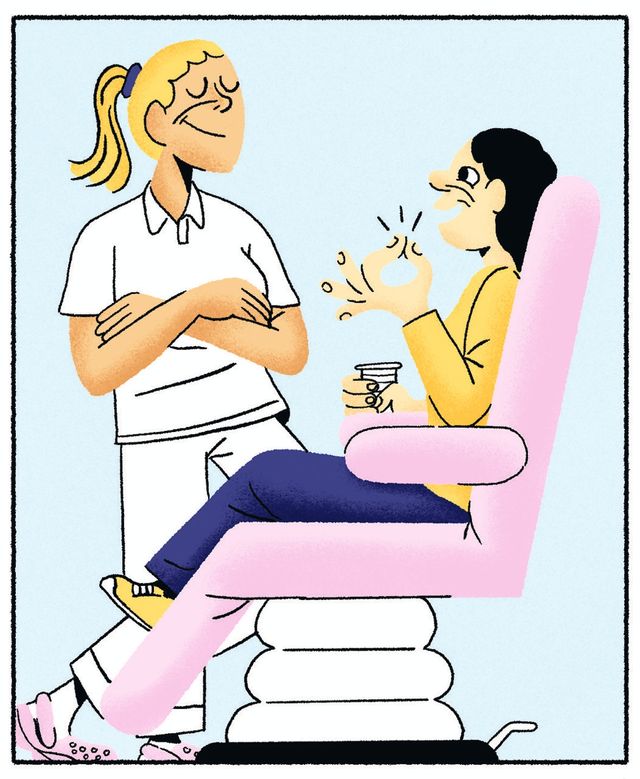
Illustration: Marvin Traber
Nur ein Ja heißt Ja, auch auf dem Zahnarztstuhl. Als vor ein paar Jahren die Debatte um das schwedische Ja-heißt-Ja-Gesetz nach Deutschland kam, also um die große Frage, wie sichergestellt werden kann, ob beide Seiten wirklich miteinander schlafen wollen und nicht nur nicht Nein sagen, fanden viele Zeitungskommentierende das noch lustig: Jetzt müssen die Schweden vorm Sex auch noch reden, wie absurd! Aber Reden hilft halt, sei es vorm Sex oder vor einer Wurzelbehandlung. Schließlich provoziert jede Frage beim Gefragten ein Nachdenken über die Antwort. Und gerade auf dieses Nachdenken über das, was einen erwartet, kann man sich im Nachhinein besinnen, um sich zu sagen: Ich hätte Nein sagen können, aber ich wollte es so. Weil auch eine schlechte Entscheidung immer noch besser ist als eine, die man nicht selbst getroffen hat.
Ich wünsche mir mehr Darf-Ichs in meinem Leben, nicht nur beim Arztbesuch: Darf ich dich vor zehn Uhr morgens zum Quatschen anrufen? Nein! Darf ich mit dreckigen Schuhen in deine Wohnung latschen? Nein! Darf ich als Fremder unvermittelt in deinen Kinderwagen greifen und deinem Baby den Bauch tätscheln? Nein! Darf ich mich im ICE an dir vorbeiquetschen, ohne auch nur einen Ton zu sagen, und danach genervt den Kopf schütteln? Es gäbe so viele Neins zu verteilen.
Es gibt aber auch die widerwilligen Darf-Ichs, von denen ich vermute, dass sie in der Hoffnung gestellt werden, dass der Gefragte »Nein« sagt. Darf ich dir beim Schnippeln oder Kochen helfen? Beim Abräumen oder Abwaschen? Viel zu leicht geht mir in diesen Momenten ein »Nein« über die Lippen. Nein danke, das schaffe ich schon. Nein, nein, das Essen ist eh gleich fertig. Ach nee, das ist ja nicht mehr viel zum Abwaschen – während sich vor mir die Töpfe und dreckigen Weingläser stapeln. In diesen Momenten lobe ich mir diejenigen, die nicht um Erlaubnis bitten, sondern einfach mit anpacken.
Erst sah es übrigens so aus, als hätte meine frühere Zahnärztin beim Aufbereiten der Wurzelkanäle größere Schäden angerichtet – was sich zum Glück nicht bestätigte, sonst hätte der Zahn rausgemusst. Als die neue Zahnärztin dann nach einer guten Stunde fertig war mit der Behandlung, tätschelte sie meinen Arm und lobte meinen Körper für seine Selbstheilungskräfte. »Sie können wirklich stolz auf sich sein«, sagte sie. Ich lächelte betäubt.