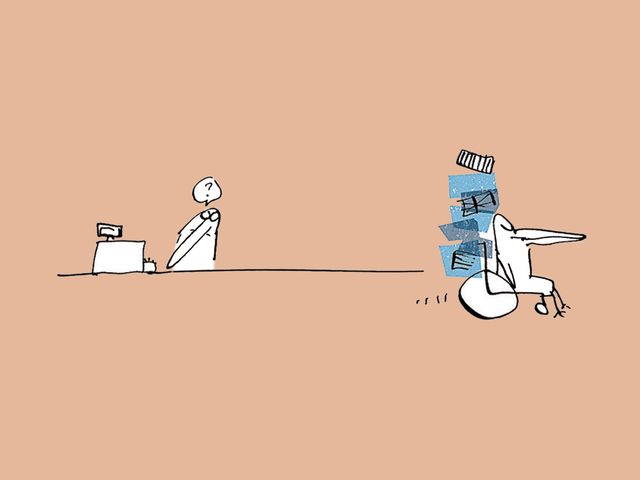»Unser Politikanspruch läuft darauf hinaus, dass die Gesellschaft zu gestalten keine arbeitsteilige Spezialität sein soll, wo die einen die Politik machen, während die anderen, und das ist die übergroße Mehrzahl, deren Folgen ausbaden«, schreibt die Soziologin Frigga Haug in ihrem Buch »Die Vier-in-einem-Perspektive«. Sie plädiert für eine Gesellschaft, in der es nicht nur theoretisch möglich ist, dass alle Menschen ihren politischen Willen artikulieren können, sondern konkrete Möglichkeiten geschaffen werden, damit politische Beteiligung eine Alltagspraxis wird. Hinter diesem politischen Anspruch bleibt unsere »Bürger*innengesellschaft« jedoch bislang zurück, da insbesondere politisches Engagement vorraussetzungsvoll ist und nicht alle Menschen auf gleiche Art willkommen heißt.
Damit sich alle Menschen politisch beteiligen können, so Haug, sei es zudem nötig, »dass wir auch Zeit brauchen, in die Gestaltung der Gesellschaft einzugreifen«. Deshalb hat sie vorgeschlagen, dass Menschen jeweils die gleiche Summe Zeit – vier Stunden am Tag – für die drei Lebensbereiche Erwerbsarbeit, Fürsorgearbeit, Kultur und Politik aufwenden können sollten. Ein Recht auf Beteiligung, wie es zahlreiche andere politische Autor*innen und Expert*innen fordern, setzt unter anderem voraus, dass jede Person, die sich zivilgesellschaftlich engagieren möchte, die Zeit hat, das zu tun.
Eine Demokratie wird erst mit einem breiten bürgerschaftlichen Engagement lebendig
Eine Demokratie wird erst mit einem breiten bürgerschaftlichen Engagement lebendig. Zwar sind die Menschen in Deutschland stark engagiert – rund 40 Prozent der Bürger*innen engagieren sich freiwillig in den unterschiedlichsten Initiativen –, jedoch wirken hier ähnliche Exklusionsmechanismen wie in anderen Gesellschaftsbereichen. Menschen mit einer hohen formalen Bildung, aus höheren Einkommensgruppen, ohne Migrationsgeschichte und solche, die sich subjektiv gesund fühlen oder keine Erkrankungen haben, sind im freiwilligen Engagement überrepräsentiert. Hingegen werden »Erwerbslose, sozial Benachteiligte und Zugewanderte (…) von der Gesellschaft, aber auch von vielen Engagierten und ihren Organisationen allenfalls als Objekte von Wohltätigkeit, nicht aber als (potenziell) Engagierte eigenen Rechts mit eigenen Stärken, Ideen und Gestaltungsabsichten wahrgenommen«, heißt es in einem Expertise-Papier der Friedrich-Ebert-Stiftung. Belegt wird die Ungleichheit im Engagement auch durch den jüngsten Freiwilligensurvey, der im März veröffentlicht wurde, in dem es unter anderem heißt: »Die Engagementquote bei Personen mit hoher Schulbildung liegt bei 51,1 %, bei Personen mit mittlerem Bildungsabschluss bei 37,4 % und bei Personen mit niedrigem Bildungsabschluss bei 26,3 %. Die Bildungsunterschiede im freiwilligen Engagement haben zwischen 1999 und 2019 zugenommen.«
Wer sich mit Diskriminierung befasst, wird von diesen Ergebnissen nicht überrascht sein. Warum sollten sich die Möglichkeiten im Ehrenamt von denen in der Berufswelt und in der Politik unterscheiden? Da zivilgesellschaftliches Engagement jedoch zur politischen Willensbildung beiträgt und Einfluss darauf hat, welche gesellschaftlichen Themen Beachtung finden, muss sich auch dieser Bereich dringend wandeln. Bürgerschaftliches Engagement muss inklusiv sein, denn sonst »dient das Engagement nicht dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern zementiert bestehende Strukturen der Ungleichheit und Ungerechtigkeit«, schreiben die Autor*innen der FES-Expertise.
Daher sollten die hohen Engagement-Quoten in Deutschland differenziert betrachtet werden. Denn das Freiwilligensurvey fasst alle Arten des freiwilligen Engagements zusammen, ohne zu prüfen, welche Initiativen und Themenfelder tatsächlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, politische Interessen bündeln und artikulieren oder sich darum bemühen, demokratiegefährdenden Tendenzen entgegenzutreten. Derzeit umfassen die Statistiken zum freiwilligen Engagement auch Vereine, die antidemokratisch agieren, in denen nicht gemeinwohlorientiert gewirkt wird, in denen Menschen unter sich bleiben und ihre eigenen Privilegien abschirmen und ausbauen. Auch Selbsthilfegruppen, die ohne Zweifel eine wichtige Funktion für die dort eingebundenen Menschen erfüllen, fallen unter das freiwillige Engagement. Man sollte daher von der absoluten Engagement-Quote nicht darauf schließen, dass sich 40 Prozent der Deutschen im Sinne von Politikgestaltung in die Gesellschaft einbringen. Daher wäre es wichtig, mehr darüber zu wissen, welche Anteile des Engagements tatsächlich dem zivilen Engagement zuzuordnen sind – Engagement, das einen solidarischen Umgang fördert und unsere Gesellschaft gerechter, offener, durchlässiger und inklusiver macht.
Damit Menschen sich überhaupt in Vereinen, Initiativen oder der ehrenamtlichen Kommunalpolitik einbringen können, müssen sie also »eingeladen« sein, was heißt, dass sie angesprochen werden, sich erwünscht fühlen, die Voraussetzungen für eine Teilnahme möglichst barrierefrei sind und mehr Menschen Unterstützung dabei bekommen, selbst zivilgesellschaftliche Organisationen zu gründen. Sie müssen die Zeit haben, sich neben anderen Verpflichtungen wie Erwerbsarbeit, Bildung und Care-Aufgaben engagieren zu können. Dass die Bildungsunterschiede im freiwilligen Engagement sich verstärkt haben, könnte auch damit zusammenhängen, dass irreguläre Arbeitszeiten sich ausgeweitet haben und besonders Menschen mit geringerer Qualifikation betreffen. Forschungsdaten zeigen, dass Schicht- und Wochenendarbeit sich nachteilig darauf auswirken, sich in einem Ehrenamt engagieren zu können.
Materielle Sicherheit ermöglicht die Freiheit, sich für andere Belange als das eigene Überleben zu interessieren und einzusetzen
Ein weiterer Faktor, der ein- und ausschließen kann, ist die materielle Absicherung: Engagement muss man sich leisten können. Prekäre Beschäftigung und Erwerbslosigkeit stellen aktuell eine Hürde für Menschen dar, um sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, daher hängt das Ideal, dass sich möglichst viele Menschen gesellschaftlich einbringen können, untrennbar damit zusammen, dass die wirtschaftliche Existenz aller gesichert ist und Diskriminierung im Bildungsbereich reduziert wird. Materielle Sicherheit ermöglicht die Freiheit, sich für andere Belange als das eigene Überleben zu interessieren und einzusetzen. Daher ist Engagement-Politik nur als Querschnittsthema zu begreifen, das nicht losgelöst von vielen anderen Politik-Bereichen wie dem Arbeitsmarkt, Bildungsgerechtigkeit, Anti-Rassismus oder Inklusion behandelt werden kann.
Eine feministisch positive Nachricht aus dem aktuellen Freiwilligensurvey ist, dass das Engagement von Frauen aufgeschlossen hat und sich nicht mehr signifikant von dem der Männer unterscheidet. Allerdings lohnt sich auch hier ein Blick darauf, welche Frauen sich mehr engagieren können als andere: Diejenigen, die in einem geringeren Umfang erwerbsarbeiten. »Je größer der Anteil der wöchentlichen Arbeitsstunden bei Frauen, desto geringer ist ihr zeitlicher Einsatz für ehrenamtliche Aktivitäten«, heißt es in einem Bericht des Wissenschaftszentrum für Sozialforschung. Die weibliche Zivilgesellschaft wird getragen von Frauen, die in Teilzeit arbeiten, schon in Rente sind und weniger in Care-Aufgaben eingebunden sind als Mütter oder pflegende Angehörige. Eltern, insbesondere Mütter, engagieren sich vor allem in den Kindergärten und Schulen ihrer Kinder, was eben kein unmittelbar gemeinwohlorientiertes Engagement ist, sondern sich eher als Erweiterung der familiären Carearbeit oder auch als »immaterielle Investition in die Zukunft der eigenen Kinder« betrachten lässt, so formuliert es ein Soziolog*innen-Team in einem Fachaufsatz zum Engagement von Frauen. Was als Engagement klassifiziert wird, kann auch Egoismus sein.
Der Kritik daran, dass Eltern sich vor allem für ihre Kinder engagieren, kann man jedoch auch entgegenhalten, dass Kindergärten und Schulen auf die Mitarbeit von Eltern angewiesen sind oder es viele Kitas ohne Elterninitiativen gar nicht gäbe. Familien fangen hier mit ihrem freiwilligen Engagement auf, was eigentlich Aufgaben des Staates wären, die dieser unzureichend leistet. Eine bessere Finanzierung der Bildungseinrichtungen könnte damit Eltern den Freiraum geben, sich in Ehrenämtern einzubringen, die nichts mit ihrer Familie zu tun haben und die sie vielleicht sogar deutlich mehr interessieren. Wer als Mutter lieber Zeit dafür hätte, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren oder als Fußballtrainerin, sollte sich vom Ehrenamt in der Schule befreien und die Väter in die Pflicht nehmen, die im freiwilligen Engagement im Bildungsbereich bislang unterrepräsentiert sind.
Ohnehin sind die Effekte der Geschlechtszugehörigkeit im Ehrenamt bemerkenswert: Während berufstätige Frauen, die viel arbeiten, offenbar weniger Zeit oder andere Ressourcen dafür finden, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, steigt die Engagement-Quote von Männer entlang ihrer Arbeitszeit. Das Eingebundensein im Beruf scheint Männer eher zu bestärken, sich zusätzlich nach Feierabend in einem Verein zu engagieren. Hohe berufliche Stellungen, die verbunden sind mit langen Arbeitszeiten, wirken sich darauf aus, für Ehrenämter ›gefragt‹ zu sein. Frauen hingegen scheinen eher Freiraum von beruflichen Aufgaben brauchen, um sich engagieren zu können. Eine Erklärungsmöglichkeit könnte sein, dass aufgrund der unterschiedlichen Bereiche, in denen sich Männer und Frauen engagieren, Männer ihr Engagement eher als Ausgleich empfinden und Frauen eher als arbeitsähnliche Tätigkeit, die sie fordert und weniger freizeitlich erlebt wird als die Ehrenämter der Männer. Denn am häufigsten sind Männer im Bereich Sport, Freizeit und Geselligkeit engagiert, Frauen in Kirchen, im sozialen Bereich und, wie bereits erwähnt, in Schulen und Kitas.
Die Daten zum Engagement von Müttern und Väter zeigen zudem, dass Männer mit Kindern sich häufiger engagieren als Frauen mit Kindern. Der Gender-Care-Gap, der beschreibt, dass Frauen in Familie und Haushalt mehr Zeit einbringen als Männer, zeigt sich also auch in der Beteiligung am freiwilligen Engagement. Die Wissenschaftlerinnen Christina Klenner und Svenja Pfahl formulieren diesen Fakt mit leichtem Sarkasmus: »Auf Grund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung entlasten sich Männer, die in Partnerschaft leben, weitgehend von sonstigen unbezahlten Tätigkeiten im Reproduktionsbereich über die Partnerin.« Männer nehmen sich die Zeit für ihre Ehrenämter, die ihren Partner*innen, die für die Aufgaben zuhause zuständig erklärt werden oder sich zuständig fühlen, dementsprechend fehlt.
Eine Gesellschaft, die sich ein starkes und vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement wünscht, muss sich die Frage stellen, wie sie Zeitgerechtigkeit für politische Partizipation ermöglicht
Als Gründe dafür, sich nicht ehrenamtlich zu engagieren, nennen Menschen am häufigsten, nicht die Art des Engagements gefunden zu haben, die zu ihnen passe. In dieser Antwort verbergen sich auch die Themen Inklusion und Diversität, da ein Ehrenamt nicht nur thematisch ausgewählt wird, sondern auch nach der Willkommenskultur in der jeweiligen Organisation. Das kommunalpolitische Engagement wird zum Beispiel erschwert, wenn Interessierte sich in der Gruppe in einer Minderheit befinden und sich verstellen sollen, um akzeptiert zu werden oder sogar offen diskriminiert werden. Auch über strukturelle Besonderheiten wie Zusammenkünfte, die nur am Abend stattfinden, werden insbesondere Mütter und alleinerziehende Eltern vom Engagement ausgeschlossen. Als zweithäufigste Hinderungsgründe für ein freiwilliges Engagement werden sowohl Dauer und Lage von Arbeitszeiten als auch berufliche Belastungen genannt. Zu den häufigsten Abbruchgründen für ein Engagement gehört Zeitmangel. Zivilgesellschaftliches Engagement sollte daher in zeitpolitische Konzepte – die verkürzt als »Vereinbarkeit« beschrieben werden – miteinbezogen werden. Eine Gesellschaft, die sich ein starkes und vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement wünscht, muss sich die Frage stellen, wie sie Zeitgerechtigkeit für politische Partizipation ermöglicht.
Diese Frage den Unternehmen zu überlassen, ist zu wenig, da Arbeitgeber im Niedriglohnsektor oder in Branchen mit hohem Personalmangel wie in der Pflege, von sich aus vermutlich nicht auf die Idee kommen, die Arbeitszeit ihrer Angestellten bei Lohnausgleich zu verkürzen. Beschäftigten, die gewerkschaftlich gut organisiert sind oder in finanzstarken Branchen arbeiten, bekommen bereits jetzt über Tarifverträge kürzere Arbeitszeiten, mehr freie Tage, flexiblen Überstundenabbau oder sogar konkret freie Zeiten für Engagement von ihren Arbeitgebern angeboten. Und diese Menschen finden sich bereits vermehrt in Ehrenämtern. Daher braucht die Stärkung der Zivilgesellschaft politische Lösungen, um allen Menschen die Zeit zu gewähren, die sie für freiwilliges Engagement benötigen. Denn der jüngste Freiwilligensurvey zeigt auch, dass die Zeit, die Ehrenamtliche pro Woche für ihre Aktivitäten aufwenden können, seit dem letzten Survey gesunken ist. Diese Entwicklung könnte sich zum einen auf die Nachhaltigkeit von Initiativen auswirken, da sich Menschen somit eher punktuell und für kurzfristige Projekte engagieren. Zum anderen brauchen der Wandel der Initiativen hin zu einer inklusiven Organisationskultur sowie Neugründungen für bislang zu wenig besetze Themen noch einmal zusätzliche Zeit.
Wer schenkt also der Zivilgesellschaft diese Zeit? Die Corona-Pandemie hat in vielen Menschen das Bedürfnis geweckt, sich für andere einsetzen zu können und auch, endlich wieder mit anderen zusammenzukommen und gemeinsam an Zielen zu arbeiten, die größer sind, als den Tag Zuhause herumzubekommen. Wir sollten es als Chance begreifen, dass das freiwillige Engagement durch die lange Zeit der Isolation voneinander im nächsten Jahr mehr Zulauf bekommen könnte, wenn die Voraussetzungen dafür gut sind. Auch der Wunsch danach, sich abseits des bisherigen Jobs zu engagieren, um in Bereichen zu arbeiten, deren Bedeutung durch die Corona-Krise mehr Menschen bekannt geworden ist, könnte Anlass dafür sein, zivilgesellschaftliche Sabbaticals zu ermöglichen. Die 35-jährige Berlinerin Franzi Kempis etwa, die normalerweise für Daimler arbeitet, hat sich von ihrem Job dort für ein mehrmonatiges Sabbatical freistellen lassen, um in diesem Frühjahr ein Impfzentrum in Berlin zu leiten. »Ich kann aus meiner Zeit im Impfzentrum ganz viel mitnehmen«, sagt Kempis, »vielleicht auch, was es bedeutet, an einem Ort der Hoffnung arbeiten zu dürfen, in diesen Zeiten, die für uns alle schwer sind.«
Wir sollten aus Beispielen wie diesem Ideen dafür entwickeln, wie das zivile Engagement in Deutschland gestärkt werden könnte und nicht nur der Gesellschaft dient, sondern auch mehr Menschen ermöglicht, ihre Interessen und Werte abseits ihres gewohnten Berufs zu verwirklichen. Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) schlägt in ihren Reden und Interviews immer wieder vor, eine neue Art des Zivildienstes wieder einzuführen, den Menschen nach einer Phase der Berufstätigkeit aufnehmen, um sich Perspektivwechsel zu ermöglichen, die ohnehin notwendig werden, wenn Berufe verschwinden und neue entstehen. Dass lebenslanges Lernen und berufliche Wechsel in Zukunft für noch mehr Menschen dazugehören werden, haben viele Parteien schon erkannt. In den bereits veröffentlichten Wahlprogrammen von SPD, Grünen und Linken finden sich Vorschläge dazu, ein »Recht auf Weiterbildung« oder geförderte Bildungszeiten für berufliche Wechsel einzuführen.
Meine Idee wäre, außerdem ein Jahr für Engagement zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr zu ermöglichen – unabhängig davon, ob jemand den Beruf wechseln möchte oder als Teil einer Weiterbildungszeit. Vielleicht auch ein zweites Mal zwischen 50 und 70. Die Forschung zum Renteneintritt zeigt, dass viele Menschen gern nach ihrer Berufszeit ein wenig weiterarbeiten würden und der abrupte Wechsel von Vollzeit auf Rente für manche Ältere vor Probleme stellt, ihren Alltag zu strukturieren und ihre Identität zu definieren.
Es wäre deswegen interessant, ein Engagement-Jahr zur Pflicht zu machen oder ein Recht darauf zu schaffen, damit tatsächlich alle Menschen mit zivilgesellschaftlichem Engagement in Berührung kommen und sich Organisationen auf Vielfalt einstellen müssen. Immer wieder geschieht es, dass Menschen in einer längeren Elternzeit klar wird, dass sie nicht zu ihrer vorigen Stellen zurückkehren möchten und sich innerhalb der Elternzeit oder danach neu orientieren, etwas gründen, eine weitere Ausbildung machen oder den Quereinstieg in andere Branchen wagen. Andere, die nicht zufrieden sind in ihrem Job, merken, dass sie sie die Neuorientierung nicht schaffen, während sie weiterarbeiten, sondern zunächst kündigen und Abstand gewinnen müssen, um sich klar darüber zu werden, wie es weitergeht. Auch für diese Situation und für alle, die nicht Eltern werden und dennoch eine Pause von der Erwerbsarbeit brauchen, wäre ein Engagement-Jahr eine Option für neue Erfahrungen und eine Möglichkeit, Auszeiten und Orientierungsphasen zu normalisieren. Gestaltungsmöglichkeiten gäbe es viele: etwa auch als Sechs-Monats-Modell, Vier-Tage-Woche oder 25-Stunden-Woche, kombiniert mit weiteren Bildungsangeboten.
Sicherlich wäre es falsch, Engagement zu erzwingen – aber wir könnten uns darum bemühen, dass es normal und für alle möglich wird, sich zivilgesellschaftlich einzubringen und andere Formate der politischen Beteiligung auszuprobieren als nur zu wählen. Hätten Sie eine Idee, was Sie mit einem geschenkten sozialen Jahr machen würden? Überlegen Sie mal. Die Pandemie ist irgendwann vorbei und es wird viel zu tun geben. Und selbst einige Stunden in der Woche können viel bewegen. Ein Engagement-Nachmittag könnte der Anfang sein.