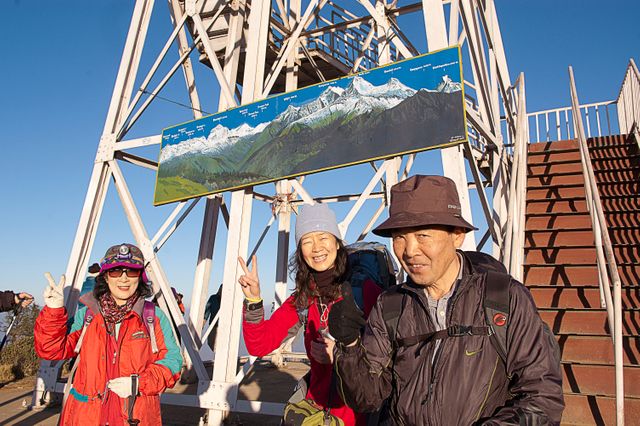Name: Adriano Marzi
Geboren: 1976 in Rom
Wohnort: bei Rom
Ausbildung: Umweltökonomik in der Terza Università di Roma und Entwicklungswirtschaft bei IUSS Pavia
Website: www.adrianomarzi.com
SZ-Magazin: Herr Marzi, sind Sie selbst Bergsteiger?
Adriano Marzi: Ja natürlich, ich liebe das Bergsteigen.
Haben Sie dadurch von der Situation der Sherpas erfahren?
Ja. Ich bin durch den Osten Nepals gereist und durch die Region zwischen dem an Indien angrenzenden Flachland und dem Himalaya-Gebirge gewandert. Dabei musste ich auch mehrere Bergpässe überqueren. Ich war also auf die Hilfe von Trägern angewiesen, die üblicherweise Sherpas genannt werden. Der Begriff Sherpas bezeichnet eigentlich die Bewohner von Regionen im Osten Nepals. Heute werden so allerdings alle genannt, die als Träger arbeiten - auch wenn sie aus einer anderen Gegend stammen.
In der Hochsaison im April und Mai zieht das Himalaya-Gebirge Hunderte Menschen an, die sich unter anderem am Mount Everest ausprobieren wollen. Was bedeutet dieser Massentourismus für die Sherpas?
Für die Sherpas hat das Ganze zwei Seiten. Einerseits bietet es ihnen die Möglichkeit zu arbeiten. In Nepal ist diese Art von Arbeit sehr üblich, denn die Menschen haben nicht viele Optionen, selbst wenn sie gebildet sind. Tourismus ist einer der wichtigsten Sektoren für die nepalesische Wirtschaft und gerade für viele junge Menschen ist die Arbeit als Träger attraktiv. Andererseits kann die Arbeit der Sherpas tödlich sein. Im letzten Jahrhundert sind am Mount Everest etwa 300 Menschen gestorben, rund ein Drittel davon waren Sherpas. 2014 starben 16 Sherpas bei einem Lawinenrutsch. Heute wollen viele Menschen den Mount Everest besteigen, auch wenn sie viel zu unerfahren sind. Diese Menschen sind bereit, viel Geld für den Aufstieg zu zahlen. Die Sherpas verrichten dann alle gefährliche Arbeiten, die für den Aufstieg nötig sind: Sie bereiten die Strecke vor, fixieren Seile oder tragen Sauerstoffreserven. Sie riskieren ihr Leben und zahlen einen hohen Preis.
Was haben Sie bei diesem Projekt über die Sherpas gelernt?
Sie sind sehr stark und großzügig. Die Sherpas waren ursprünglich nicht am Bergsteigen interessiert, bis dieser riesige Markt entstanden ist. Sie werden also durch die wirtschaftliche Situation ihres Landes gezwungen, eine Arbeit zu verrichten, die bereits viele Leben gekostet hat. Sie glauben, dass die Berge von Göttern bewacht werden und respektieren das Gebirge. Wenn sie heute Expeditionen begleiten, beten sie zuvor und bitten um Erlaubnis, den Berg erklimmen zu dürfen. Im Gegensatz zu den Touristen liegt ihnen nicht viel daran, den Gipfel zu erreichen. Das ist ein westlicher Reiz. Die Sherpas können die Schönheit und die Kraft der Berge auch aus den Tälern spüren.
Sie dokumentieren, wie der Tourismus die Sherpas ausbeutet. Sollten Besucher dann nicht lieber ganz auf die Hilfe der Sherpas verzichten?
Das ist eine schwierige Frage, die jeder für sich beantworten muss. Ich stimme mit den Sherpas überein und denke, dass die Schönheit von Bergen auch mit Abstand zu erkennen ist. Das war zum Beispiel meine Erfahrung mit dem Mount Everest. Es ist verständlich, dass viele Sherpas große Risiken eingehen, denn mit nur einer Expedition können sie genug Geld verdienen, um sich ein Haus zu kaufen. Gerade deswegen liegt es in den Händen der Tourismusbranche, ethischer zu handeln. Es sollten nicht einfach alle Menschen jeden Berg besteigen dürfen. Gerade unerfahrene Bergsteiger bringen nicht nur sich selbst, sondern auch diejenigen, die ihnen helfen, in Gefahr.
Wie haben die Sherpas darauf reagiert, von Ihnen fotografiert zu werden?
Die meisten waren sehr offen. Es kommt auf die Art und Weise an, wie man von ihnen Bildern macht. Ich traf Menschen, trat mit ihnen in Kontakt, konnte mich mit ihnen austauschen und wir verbrachten teilweise mehrere Tage gemeinsam. Meine Reise begann in einer Region, in der es kaum Infrastruktur gibt. Dementsprechend baute ich eine enge Beziehung mit den Sherpas auf.